Im Kreis der Geschichte
Kurapaty sei zurück, konstatiert der belarussische Autor Adam Swirgul, in seinem Essay über die Bedeutung der Massengräber nordwestlich von Minsk, an der Ringautobahn. Swirgul, der aus Angst vor Repressionen unter Pseudonym schreibt, ist überzeugt, dass die Geister des Stalinistischen Terrors nur besiegt werden können, wenn die Belarussen lernen, sich mit der Wahrheit der Geschichte auseinanderzusetzen. Dies wiederum ist auch ein Weg, die Lukaschenkosche Diktatur hinter sich zu lassen.
Letztens habe ich mir ein Spiel ausgedacht.
Ich stelle mir vor, wie ich mich ins Auto setze und über die Minsker Ringstraße fahre – die Autobahn, die sich wie ein Kreis um meine Stadt schließt.
Ich sehe die Schornsteine und Betonquader des Zugmaschinenwerks. Hier werden Transportgiganten gebaut, die auf ihren Rücken gehorsam Nuklearraketen durch die unendlichen Weiten des Imperiums schleppen, mit denen man die ganze Welt zerstören kann.
Ich sehe die Wohnblocks von Kamennaja Horka, die sich wie Gebirgskämme bis zum Horizont erheben. In Tausenden von Fenstern spiegelt sich feuerrot die untergehende Sonne.
Ich sehe den Spiegel des Stausees von Drasdy, an dessen Ufern in der Ferne die Silhouetten von Wolkenkratzern aus dem Nebel ragen und in der Tiefe des dunklen Waldes eine für fremde Augen unsichtbare elitäre Siedlung verborgen liegt – die Residenz des Tyrannen.
Weshalb dieses Spiel?
Weil ich schon seit zwei Jahren nicht mehr in Minsk war.
Ich kann stolz auf mich sein. Wenn ich langsam und vorsichtig fahre, kann ich die ganze sechzig Kilometer lange Ringautobahn ohne größere Gedächtnislücken in meiner Vorstellung abfahren.
Doch wenn eine Straße ein Ring ist – wo beginnt man dann? Üblicherweise starte ich dort, wo die Strecke über einen niedrigen, mit Kiefern bewachsenen Hügel führt. An seinen Hängen stehen schlichte Kreuze, die einander gleichen wie Geschwister. Dieser Ort heißt Kurapaty.
Der erste Marsch
Als ich Kurapaty vor vielen Jahren zum ersten Mal besuchte, ging ich zu Fuß hin. Jedes Jahr an Dsjady, dem Tag, an dem man den Toten gedenkt, fand eine Prozession vom Stadtzentrum aus nach Kurapaty statt. Die Menschen trugen Kerzen, halblegale weiß-rot-weiße Flaggen und eine große Glocke, die von Zeit zu Zeit im Rhythmus der Schritte geläutet wurde. Mein Vater, der immer zu solchen Veranstaltungen ging, hatte mich zum ersten Mal mitgenommen. Ich hatte Angst, dieses geheimnisvolle Kurapaty zu sehen. Würde es dort nicht furchterregend sein, auf den namenlosen Gräbern, in denen in mehreren Schichten Menschen lagen, ermordet von Stalinisten in den 1930er Jahren?

Der Marsch nach Kurapaty nahm seinen Anfang auf der zentralen Straße der Stadt, inmitten der stuckverzierten Prachtbauten im sogenannten Stalin-Stil, und führte durch die endlosen, nichtssagenden sowjetischen Plattenbaugebiete, in denen sich Wohnung an Wohnung und Etage an Etage reiht. Deren Bewohner hängten auf den Balkonen Wäsche auf, gingen einkaufen oder standen einfach da und beobachteten erstaunt bis skeptisch diese Menschen mit Flaggen und Kerzen, die durch ihre Nachbarschaft strömten.
Schließlich erreichte der Zug die Unterführung an der Ringautobahn. Im Zwielicht des Tunnels verstummten alle Geräusche der Stadt mit einem Mal. Nur die Schritte der vielen Füße blieben, hallten von den Wänden wider.
Die Präsenz des Bösen
Jenseits des Rings begann eine völlig andere Welt. Schweigend gingen die Leute in einer langen Kolonne auf den Wald zu, der von den roten Flämmchen kleiner Grabkerzen erfüllt war.
Der ausgetretene Pfad führte auf den Gipfel eines kiefernbewachsenen Bergs. Dort, zwischen den höchsten Kreuzen in der Mitte, hielten die Leute Ansprachen, lasen Gedichte, beteten und sangen leise. Dann, nach einer Schweigeminute, streiften alle zwischen den Kiefern und Kreuzen umher, als versuchten sie, die Namen derer zu erraten, die da liegen, in den grasbewachsenen Grabmulden auf den Hügeln von Kurapaty.
Und obwohl es im Wald von Kurapaty ganz still war, empfand ich keine Ruhe. Eher eine leise Anspannung, ein Pulsieren, das den Körper durchdringt, wie wenn man sich einer sehr starken Energiequelle nähert.
Ich versuche, ein allgemein bekanntes Bild zu finden, das mein Gefühl in diesem Moment beschreibt. Mir kommt Stanley Kubricks Film 2001: Odyssee im Weltraum in den Sinn. Menschen in Astronautenanzügen nähern sich ganz langsam einem geheimnisvollen schwarzen Monolithen, den sie in einem Mondkrater entdeckt haben. Niemand kennt seine Bedeutung, doch die Szene ist beherrscht von dem Gefühl, dass etwas Großes bevorsteht, eine Begegnung, nach der nichts mehr so sein wird wie zuvor.
Das Böse war ganz nah, als müsste ich nur die Hand ausstrecken
Viele Jahre später erlebte ich dieses Gefühl noch einmal – in den ersten furchtbaren Tagen der Proteste von 2020 . Mitten in einer riesigen Menge Demonstranten ging ich in der Dämmerung zu einem dunklen Platz außerhalb des Minsker Stadtzentrums. Am Ende unseres Marsches lag das Akreszina-Gefängnis, bis zum Bersten gefüllt mit frisch gefangenen Häftlingen des Tyrannen. Unter den Bäumen davor standen Zelte mit Wasser, Essen und medizinischer Ausstattung. Die Freiwilligen warteten auf den Moment, in dem man die Menschen wieder aus dem Gefängnis freilassen würde.
Auf eine mit Polizeiband abgesperrte Fläche näher am Gebäude wurden ein paar wenige Journalisten vorgelassen. Als ich über diesen schwarzen, menschenleeren Platz vor dem Gefängnis lief, spürte ich dasselbe Gefühl der Anspannung in mir aufsteigen. Hinter den Bäumen sah ich die vom gelben Licht der Straßenlaternen angestrahlte Mauer. Sich ihr zu nähern war verboten. Alle Gespräche wurden flüsternd geführt. Auf dem Dach die reglosen Schatten zweier Scharfschützen. Hinter diesen leblosen, stummen Mauern waren die Opfer verborgen. Nur dass die in Akreszina noch am Leben waren, und die in Kurapaty nicht.

Genau wie in Kurapaty spürte ich auch an den Mauern des Akreszina-Gefängnisses die Präsenz des Bösen. Es war ganz nah, als müsste ich nur die Hand ausstrecken.
Kurapaty und Akreszina – das waren die Momente, in denen in meinem Leben dieser schwarze Monolith erschien. Die Begegnung mit ihm führte aus dem Zustand des Unbewussten hinaus und verlangte danach, Fragen zu stellen. Warum ist das Böse möglich? Was kann man ihm entgegensetzen? Könnte es auch anders sein? Und was ist meine Rolle in alldem?
Schöner gelber Sand
Wassil Bykau spielte als Schriftsteller eine Schlüsselrolle in Belarus. Er hatte den Zweiten Weltkrieg als einfacher Soldat erlebt und wagte es, die Wahrheit über den Krieg zu schreiben – nicht über Heldentum, sondern über die riesige Belastungsprobe für die Menschlichkeit, der nicht jeder gewachsen war.
Die Kurzgeschichte Schöner gelber Sand [unter diesem Titel auf Deutsch erschienen, Ü: Sonja Heyl, Sinn und Form, 4/1996, S. 557-581] schrieb Bykau erst spät, in den ersten Jahren nach der Machtergreifung durch den Tyrannen. Die Handlung spielt im Lastwagen eines stalinschen Erschießungskommandos, der Häftlinge zur Exekution transportiert. Ein Bauer, ein Poet, ein ehemaliger Adeliger, ein Krimineller und ein verhafteter Offizier des NKWD sitzen darin. Aus Bykaus Beschreibung kann man schließen, dass man sie nach Kurapaty bringt. Dann bleibt der Lastwagen im Morast stecken und muss anhalten. Es ist dunkel, mitten in der Nacht. Der Wachmann befiehlt den Häftlingen auszusteigen und den Wagen aus dem Morast zu graben, damit er seinen Weg fortsetzen kann – in ihren Tod.
Was willst du machen, wehrlos, mit bloßen Händen gegen bewaffnete Henker?
Bei Bykau gibt es keine hollywoodartigen Wendungen. Keiner der Häftlinge flieht, keiner entwaffnet die Eskorte. Was willst du machen, wehrlos, mit bloßen Händen gegen bewaffnete Henker? Und wohin sollten sie fliehen? Im Umkreis von Hunderten Kilometern nichts als Imperium …
Die Häftlinge, bis zum Knie im Schlamm, schieben den Lastwagen bereitwillig voran. Einer auf Befehl des Tschekisten-Wachmanns, einer auf eigenen Willen, getrieben von Hoffnungslosigkeit, der naiven Erwartung einer Begnadigung, oder einfach dem sklavischen Wunsch zu dienen. Am Ende setzt der Lastwagen seinen Weg zum Wald am Stadtrand fort, wo alle mit einer Kugel im Kopf in den schönen gelben Sand fallen.
Denselben gelben Sand sah ich 2001, als die Behörden des Tyrannen beschlossen, Kurapaty unter dem Vorwand, die Ringautobahn ausbauen zu wollen, zu zerstören. So entstand die Kurapaty-Wache. Einige Dutzend Aktivisten wachten fast ein Jahr lang in Zelten, bei Regen und Frost, an diesem Ort der Erinnerung, um seine Zerstörung zu verhindern. Im Moment der Kulmination stand eine Menschenkette den Bulldozern gegenüber, die mit ihren Baggerschaufeln den gelben Sand von Kurapaty abgruben und drohten, die mutigen Protestierenden bei lebendigem Leibe zuzuschütten, gemeinsam mit den Erschossenen zu begraben. Die Leute, fast bis zum Knie im Sand, stellten sich den Bulldozern in einer furchtlosen Menschenkette entgegen. Der gelbe Sand war von einem Symbol für hoffnungslose Sklaverei zu einem für verzweifelten Widerstand geworden.
Die Bulldozer hielten an. Plötzlich schienen in der Geschichte des Landes nicht nur Bykau’sche Wendungen möglich.
Der „Kreuzsturz“
Die erste Prozession nach Kurapaty, organisiert von Sjanon Pasnjak, fand 1988 statt. Die eingeschüchterte Sowjetmacht versuchte, den Marsch mit Tränengas und Knüppeln auseinanderzutreiben. Seitdem ist die Sowjetmacht der Macht des Tyrannen gewichen, doch der Krieg gegen die Kreuze dauert an.
Einige Jahre nach der ersten Kurapaty-Wache begann ein erneuter Angriff auf den Gedenkort. 2017 wurde auf einer Seite der Ringstraße mit dem Bau eines Restaurants und auf der anderen eines Bürogebäudes begonnen, wobei Teile des Memorials zerstört zu werden drohten.
Die zweite Kurapaty-Wache war anders. Sie fand nicht im Wald, sondern auf der dichtbesiedelten Seite der Ringstraße statt, direkt vor den Fenstern der Wohnblöcke.
Die Agenten des Tyrannen griffen nachts an, in Zivil, versuchten, die Protestierenden zu vertreiben, von denen sich einer gar mit Handschellen an ein Polizeiauto kettete. In der Luft lag der Geruch der Lagerfeuer in Metallfässern, an denen sich die Beschützer Kurapatys wärmten. Diesmal beließen es die Bewohner der umliegenden Häuser nicht beim Beobachten. Manche von ihnen brachten den Protestierenden Essen, sorgten sich um sie.
Später, nachdem auch der zweite Angriff auf Kurapaty gestoppt werden konnte, wachten die Beschützer des Gedenkortes viele Monate lang am Eingang des neu gebauten Restaurants, um die wenigen Besucher daran zu erinnern, dass sie buchstäblich auf den Knochen der Opfer essen und trinken würden.
Doch bald würde der Tyrann seine aufgestaute Wut wieder mit neuer Kraft ausspucken. Zwei Jahre später umstellte die Polizei Kurapaty, und Bagger begannen, die Kreuze niederzureißen. Dieses Ereignis wird als „Kreuzsturz“ bezeichnet.
Die folgenden Ereignisse gleichen einem Kaleidoskop. Die Corona-Katastrophe, deren Existenz der Tyrann leugnete. Das Erwachen der Menschen, die mit dem Virus allein gelassen wurden. Die Wieder-„Wahl“ des Tyrannen, bei der es zu einem wahren Ausbruch des Lichts kam; der systematische Angriff des Bösen auf die wehrlosen Demonstranten, der daraufhin folgte. Tausende Menschen in Gefängnissen und im Exil. Und schließlich die Sintflut des neuen Krieges.
Den eigenen Namen finden
Heute ist der Wald von Kurapaty von einem Zaun umgeben – wie zu Stalins Zeiten. Nur dass am Eingangstor kein Tschekist wacht, sondern das Auge einer Überwachungskamera.
Viele der damaligen Beschützer von Kurapaty, darunter Smizer Daschkewitsch und Pawel Sewjarynez, sitzen in den neuen GULAGs des Tyrannen. Manch einer kämpft für die Ukraine. Tausende Menschen haben das Land verlassen, um dem Terror zu entkommen – so auch ich.
Ich habe nie davon geträumt, Belarus zu verlassen. Im Gegenteil, mein eigenes Leben in meinem eigenen Land aufzubauen, das war immer mein festes Vorhaben. Einer der wichtigsten Ziegelsteine in der Mauer dieser Überzeugung war Kurapaty. Es vereint in konzentrierter Form all das, was ich an Belarus liebe. Die schlichten Kreuze, geschmückt mit weißen Leinentüchern mit roten Stickmustern – wie auf alten Dorffriedhöfen. Das geheimnisvolle Rauschen der Kiefernwipfel, in denen sich der warme Wind aus den Prypjatsümpfen Palessiens mit dem kühlen Atem der nahen Ostsee mischt. Die Namen der Poeten und Schriftsteller, die von den Stalinisten vernichtet wurden, und die Gedichte und Romane, die sie zu schreiben vermochten, bevor man sie erschoss. Die Inschriften auf den Mahnmalen in belarussischer, polnischer, hebräischer und anderen Sprachen, die die Vielfalt dieses Landes widerspiegeln. All das, was ich liebe – und was das Böse so besessen zu vernichten sucht.
Kurapaty ist zurück
Heute weiß ich, dass Kurapaty nicht der Vergangenheit angehört. Das Böse ist real, stark, gnadenlos, man kann mit ihm nicht verhandeln. Bei meinem ersten Besuch in Kurapaty war mir das noch nicht so klar wie jetzt. Aber Akreszina hat es mir deutlich gemacht, und heute werde ich jeden Tag durch den Krieg daran erinnert.
Kurapaty ist zurück – denn nicht alle haben sich auf den Erinnerungsweg dorthin gemacht. Solange nicht alle Belarussen sich dessen bewusst werden, ihrem schwarzen Monolithen gegenübertreten, inmitten der namenlosen Gräber den eigenen Namen finden, solange werden wir ewig in diesem endlosen Kreis fahren, in dem nach jeder Runde ein neues Kurapaty wartet.





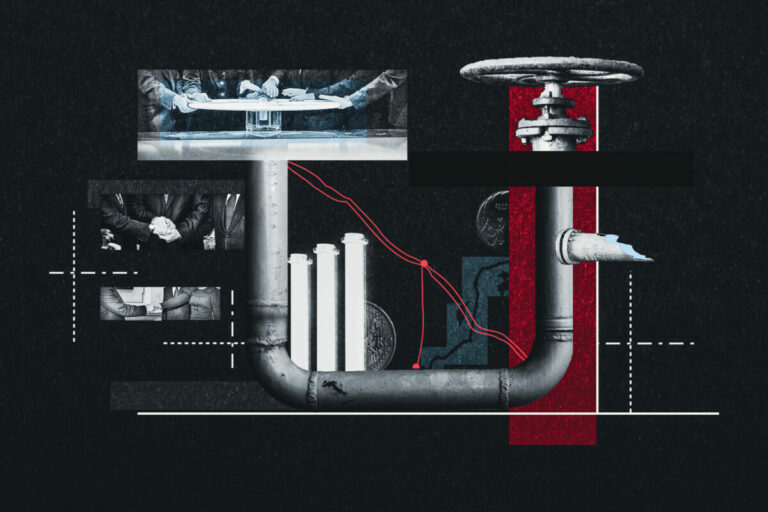




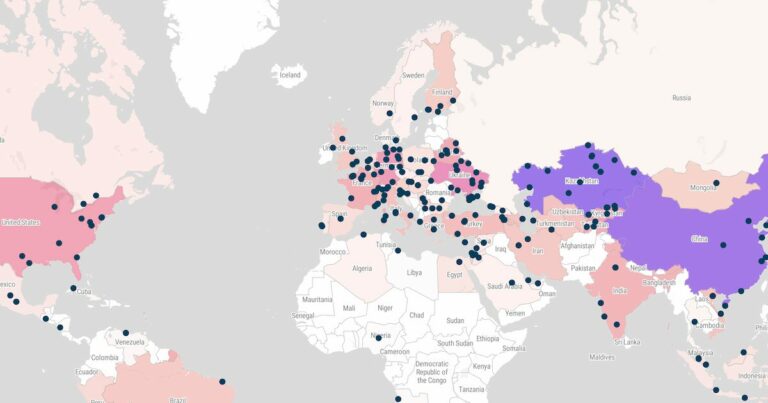





































![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)










