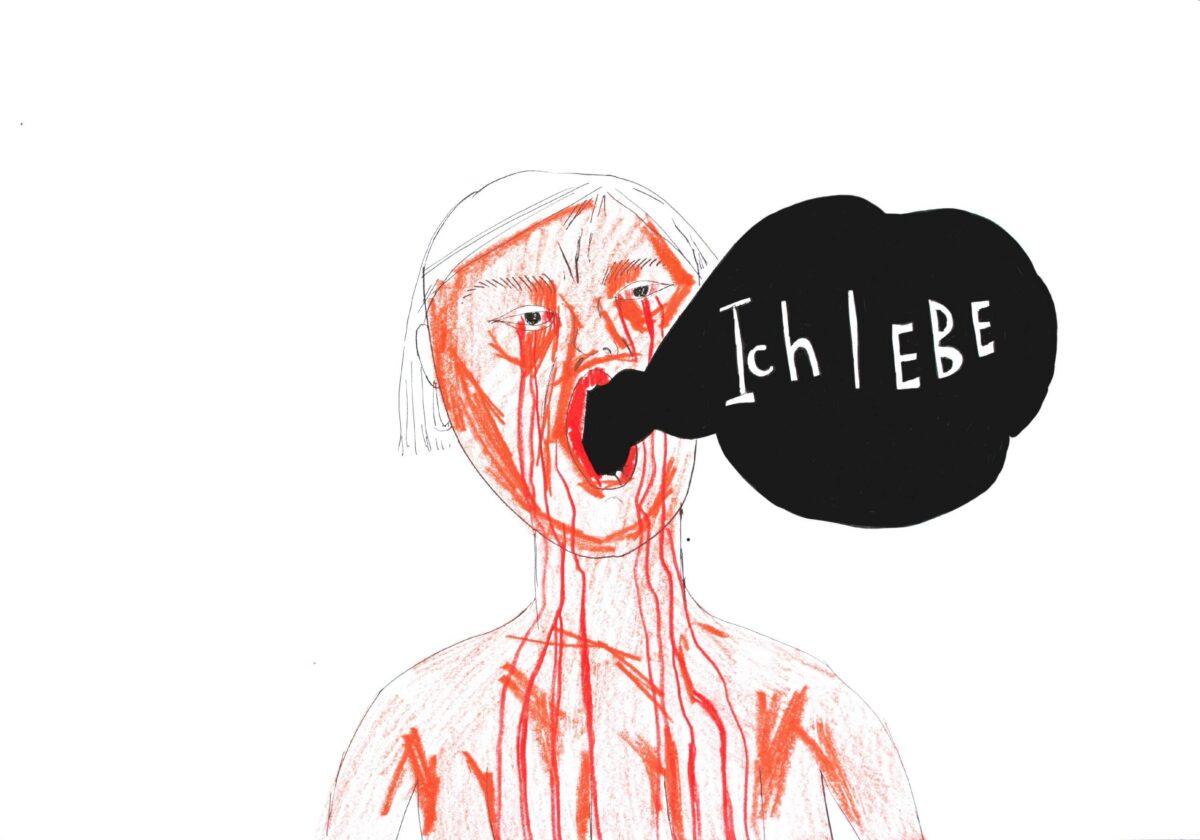
„Wirst du versuchen, über das Leben zu sprechen, wie es ist?”
50 Jahre nach seiner Veröffentlichung erscheint das Buch Feuerdörfer über die Wehrmachtverbrechen in Belarus erstmals auf Deutsch. Für Swetlana Alexijewitsch hatte das Buch entscheidenden Einfluss auf ihre Entwicklung als Schriftstellerin.
Mit der belarussischen Literaturnobelpreisträgerin haben wir über Feuerdörfer, ihren Mentor Ales Adamowitsch und über das menschliche Leiden in der Literatur gesprochen.
dekoder: Wie präsent waren die Wehrmachts-Verbrechen der sogenannten „verbrannten Dörfer“ in Ihrer Jugend?
Swetlana Alexijewitsch: Als junge Journalistin war ich viel im Land unterwegs. Überall gab es Hinweise auf die Dörfer, die im Krieg verbrannt und vernichtet worden waren. Vielerorts gab es Menschen, die sich daran erinnerten, aber viele Überlebende lebten nicht mehr an diesen Orten. Sie waren weggezogen und haben ihre Erinnerungen und Geschichten mit in die Städte genommen.
Wurde über das Thema in Ihrer Familie gesprochen?
Meine Eltern haben selten davon gesprochen. Die Erinnerung an den Krieg war schließlich überall und in vielfacher Form präsent. Aber es war gang und gebe, mehr vom Mut der Partisanen zu sprechen, vom Mut an der Front; der Schrecken des echten Leidens wurde vielfach ausgeblendet. Ihn versuchte man auch in Texten zu umgehen. Die Idee, aus der sich diese Überzeugung speiste, kam von oben. Denn das Volk war eigentlich bereit, über das Leid zu sprechen. Aber für die Führung war klar, dass der Sieg über den Faschismus ein schönes Antlitz haben sollte. Die verbrannten Dörfer und die Kirchen, in deren Flammen die Menschen umkamen, entsprachen nicht diesem Bild. Ich erinnere mich an einen Schriftsteller, der eine Novelle geschrieben hatte. In der kamen vier Menschen ums Leben. Er bekam das Manuskript vom Verlag zurück – mit dem Hinweis, dass es angebrachter wäre, nur zwei sterben zu lassen. Sowjetische Helden durften nicht so häufig sterben. Feuerdörfer zeigte schonungslos den ganzen Schrecken, den die Leute durchlebt hatten. Auch in der Schule sprachen die Lehrer nicht in dieser Art und Weise über den Krieg. Aber dort stammten alle vom Land. Und irgendwann begann man sich zu erinnern, wie das Nachbardorf in Flammen aufging, oder die Eltern erzählten, wie ihre Verwandten in den Dörfern umkamen. Diese Erinnerungen mussten ja irgendwie raus. Auch meine Mitschüler erzählten, was ihnen Großmutter oder Großvater über den Krieg berichteten. Im Leben war dieser Schrecken also tatsächlich präsent, aber nicht in der Literatur oder in der Kunst. Dort musste der Sieg als grandios und großartig dargestellt werden.

Wie haben Sie von dem Buch Feuerdörfer erfahren?
Als das Buch erschien, arbeitete ich als Journalistin. Ich habe es sofort gelesen. Der Leiter unseres Kulturressorts beauftragte mich, ein Interview mit Ales Adamowitsch zu führen. Persönlich kannte ich ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich hatte etwas Ehrfurcht vor ihm. Er war ja schon ein sehr bekannter Schriftsteller. Ich rief ihn also an und wir verabredeten uns für das Interview. Am nächsten Tag stand er dann schon in der Tür meines Büros und sagte: Ich bin vorbeigekommen, weil ich wissen wollte, wer diese Person ist, die dieses furchteinflößende Buch schon gelesen hat und die offensichtlich keine Angst hat, dazu ein Interview zu führen. Ich war damals noch sehr jung, hatte gerade das Studium beendet. Er schaute mich etwas skeptisch an und dann haben wir ein langes Gespräch geführt. Ein paar Tage später stand er wieder in meinem Büro. Er hatte diesen Drang, mit jungen Journalisten und Leuten zu sprechen. Wie ein Akademiker verhielt er sich ganz und gar nicht. Er nahm unser fertiges Gespräch an sich und kam am nächsten Tag wieder in die Redaktion. Er gab mir sehr freundschaftlich die Hand und von dem Moment an wurden wir Freunde. Für mich war dieses erste Treffen unglaublich wichtig, weil damit meine eigene literarische Geschichte begann.
Was löste die Lektüre von Feuerdörfer bei Ihnen aus?
Das Buch hat mich lange nicht losgelassen. Ich war ja das Kind von Dorfeltern und war auf dem Land aufgewachsen. Ich hatte verinnerlicht, wie die Leute dort reden. Ich spürte diese Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit, weil mir das selbst seit der Kindheit vertraut war, wie die Menschen im Dorf den Krieg erinnern. All das Grauen, das Blut, das Unfassbare des Krieges. Das alles hatte ich ja auch als junge Journalistin bei meinen Reisen durchs Land gehört. Das war ein anderer Krieg, von dem die Menschen erzählten. Ein anderer, als er in den Büchern geschildert wurde, wo ständig die Sowjets den Sieg davontrugen. Und, noch viel wichtiger: Ich spürte, wie nah mir dieser Chor aus menschlichen Stimmen war. In dieser Zeit war ich auf der Suche nach mir selbst, nach einem literarischen Genre, in dem ich mich ausdrücken konnte. Ich habe sofort gespürt, dass das Meins ist, dass meine Augen, meine Ohren und mein Gedächtnis genauso funktionieren. Nach der Lektüre habe ich verstanden, worüber und wie ich schreiben wollte. Über unsere Geschichte, über den Krieg wollte ich schreiben. Ich wollte Bücher aus menschlichen Stimmen schreiben. Die Zeitzeugen sollten die eigentlich handelnde Person in der Literatur und in der Kunst werden, weil sie die Tiefe des ganzen Grauens im Krieg deutlich machen konnten.
Wie wurde das Buch Feuerdörfer bei seinem Erscheinen aufgenommen?
Das Buch löste eine Erschütterung in der Gesellschaft aus. In dieser Art und Weise hatte noch niemand über den Krieg gelesen. Es erschien in kleiner Auflage, damit nicht so viele das Buch lesen konnten. In den Bibliotheken musste man lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um es endlich in den Händen halten zu können. Als Journalist oder Autor war es unmöglich, an dem Buch vorbeizukommen.
Und zu Adamowitsch ist sogar eine Freundschaft entstanden.
Nach dem Kennenlernen haben wir uns nicht aus den Augen verloren, haben uns bei Treffen mit anderen Schriftstellern gesehen, haben uns, so wie es die Zeit zuließ, ausgetauscht. So wurde er zu meinem Lehrer. Wie er auftrat, wie er sich gab, er war sehr mutig und hatte keine Angst, bestimmte Dinge auszusprechen. Er hatte etwas, das ihn von anderen Schriftstellern unterschied. Er hatte nicht dieses Provinzielle anhaften, was zu jener Zeit charakteristisch war für viele Schriftsteller, er strahlte etwas Europäisches aus. Wie er über Remarque sprach oder über andere Dinge, die für uns nicht zugänglich waren. Er war auch einer der ersten, die darüber sprachen, wie man über den Zweiten Weltkrieg auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs dachte und schrieb. Sänger bekommen Unterricht, um ihre Stimme zu schulen und letztlich zu verbessern. Bei mir war es das Denken, dass geschult und geschliffen wurde, wenn ich Adamowitsch gehört und gelesen habe. Meine Sicht auf die Welt wurde durch ihn geprägt und auch durch seinen Freund Wassil Bykau, mit dem ich mich schließlich auch anfreundete.
Hat Adamowitsch Sie in Ihrer Arbeit unterstützt?
Für meine eigenen Bücher hat er immer Vorworte geschrieben. Er war auch immer der erste Leser meiner Bücher. Als ich ihm das Manuskript von Der Krieg hat ein weibliches Gesicht gab, las er es innerhalb eines Tages. Ich besuchte ihn in seiner Wohnung und er sagte: Gut, dass ich dieses Buch nicht geschrieben habe. Denn er hatte auch die Idee, ein Buch über Frauen im Krieg zu schreiben. Der für ihn liebste Mensch auf der Welt war seine Mutter. Sie war Apothekerin zur Zeit der Besatzung und hatte enge Verbindungen zu den Partisanen. Ungeachtet dessen, dass sie dadurch nicht nur ihr eigenes Leben in Gefahr brachte, sondern auch das ihres Sohnes. Sie war wirklich sehr mutig. Das Vorbild der Mutter hat ihn deswegen wesentlich geprägt. Er sprach häufig von ihr. Ein Buch über Frauen im Krieg muss eine Frau schreiben, sagte er also. Viele Dinge, die du beschreibst und die das weibliche Leben ausmachen, hätte ich noch nicht mal erahnen können. Vor allem in solch extremen Situationen, wie sie es im Krieg für Frauen gibt. Ob zuhause, an der Front oder bei den Partisanen. Du hast mir diese weibliche Welt gezeigt. Für mich war das die wertvollste Besprechung unter all den tausenden, die zu meinem Buch weltweit erschienen sind. Und es war der Anfang meines Weges.
Können Sie sich an bestimmte Details aus dem Buch Feuerdörfer erinnern?
Ich erinnere mich sehr gut an Details und insbesondere an eine verstörende Geschichte, von der ich glaube, dass sie einzigartig in der gesamten belarussischen Literatur ist. Mir wurde sie auch selbst von einem Mann erzählt, als ich für Recherchen im Land unterwegs war. Im Buch wird es so erzählt: In einem Dorf wurden die Menschen in ein kleines Gebäude getrieben, das schließlich von allen Seiten angezündet wurde. Ein Junge ist darunter und er sieht, wie das Feuer seiner Mutter näherkommt und seinen Schwestern. Und er hört, wie die Mutter der kleinen Schwester, die sie auf dem Arm trägt, sagt: Warum nur habe ich dir die Gummischuhe angezogen? Deine Beinchen werden sehr lange brennen. Der Junge konnte sich schließlich aus den Flammen befreien. Aber danach kann er sich an nichts mehr erinnern. Die Deutschen waren weg, das Dorf lag in Trümmern und er fragte sich, was mit ihm passiert war. Seine Psyche hatte sich abgeschaltet. Das passiert in solch furchtbaren Momenten. Das habe ich selbst erfahren, als ich Menschen für meine Bücher befragt habe.
Es geht darum, in die Seele des Menschen zu blicken
Ich wiederhole mich, aber in der belarussischen oder russischen Literatur, die wir damals gelesen haben, gab es nichts Vergleichbares. Dort wurde sehr wenig über das menschliche Leiden geschrieben, sondern darüber, wie Partisanen ein Dorf eingenommen haben, wie sie Deutsche getötet haben. Aber darüber, was mit der Seele eines Menschen passiert, wenn man tötet, wenn die Nächsten sterben, gab es nichts. Als ich zu schreiben begann, war es genau das, was mich interessierte: Was passiert in der Seele des Menschen, wenn er töten oder sterben muss. Ein Gedanke, der sich durch Adamowitsch bei mir ausgeformt und der meine Arbeit schließlich geprägt hat, ist der, dass das Leiden eine besondere Form der Informationsvermittlung ist. Dabei geht es nicht darum herauszufinden, wer schuldig ist, wer geschossen hat, sondern darum, in die Seele des Menschen zu blicken, zu begreifen, was in solchen Momenten mit ihr passiert. Und die Menschen, die in Feuerdörfer ihre Geschichten erzählen, haben weder Tolstoi noch Dostojewski gelesen, aber sie gehen in ihren Erzählungen so viel tiefer, als es die Literatur bis dahin vermochte.
War Adamowitsch auch in anderer Hinsicht ein besonderer Autor?
Man muss das aus der Zeit heraus betrachten: Jeder Mensch, auch wenn er sehr talentiert ist, ist ein Teil der Zeit, in der er lebt. Und sie hat ihre eigenen Ideen, ihre Überzeugungen, ihre Philosophien – aber ich glaube, dass Adamowitsch einer von denen war, die ein Stück weit vorausgehen konnten. Er band sich nicht an die Linie, die uns von oben durch die offizielle Propaganda in Literatur und Kunst vorgegeben wurde. Ihn interessierten andere Dinge: Wie überlebt der Mensch, nicht nur physisch, sondern wie überlebt sein Verstand, wie überleben seine Überzeugungen? Ein sehr wichtiges Problem für unsere Literatur, das immer noch nicht richtig aufgearbeitet ist, ist das der Kollaborateure. Denn neben dem eigentlichen Krieg fand auch noch ein Bürgerkrieg statt. In dem kämpften diese zusammen mit den Faschisten gegen die Bolschewiki, die von ihnen in Gefängnisse und Lager gesteckt und von den Deutschen wieder freigelassen worden waren. Adamowitsch hat versucht, dieses Thema aufzugreifen und sich ihm zu nähern.
50 Jahre später erscheint Feuerdörfer erstmals auf Deutsch. Kann uns das Buch helfen, Antworten auf aktuelle Fragen zu finden?
Auf die Frage, warum sich Kriege und Gewalt wiederholen, ist noch keinem eine gründliche Antwort gelungen – nicht in der Religion, nicht in der Literatur, nicht in der Kunst. Es ist eins der großen Rätsel der Menschheit. Für eines meiner Bücher habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die wegen der Proteste gegen Lukaschenko im Gefängnis war. Bei dem Gespräch kamen wir auch auf diese Frage. Sie erzählte, dass sie während ihres Studiums Archipel Gulag und Doktor Schiwago lesen sollte. Ich sah mir diese dicken Bücher an, blätterte sie durch und dachte, na ja, das ist schon Geschichte, das brauche ich nicht. Und ein Jahr später fand sie sich im Gefängnis wieder und erlebte dort, was im Archipel Gulag beschrieben wird. Sie erzählte mir von einer besonders grausamen Folter. Wenn sie dir einen Cellophanbeutel überstülpen und es so ist, als würde man dich strangulieren, bis du ohnmächtig wirst, weil du keine Luft mehr bekommst. Und daraus ergibt sich diese Frage: Wie kann es sein, dass das, über was Tolstoi, Dostojewski oder Tschechow geschrieben haben, so schlecht weitergegeben wird, aber solche Foltermethoden umso leichter? Es ist eine Frage, die ich auch mit meinem Schreiben beantworten will.
Wie bleibt ein Mensch ein Mensch, wozu ist er fähig, wie kann er den Menschen in sich retten?
Und dabei habe ich immer wieder lernen müssen, wie faszinierend Menschen sind, welche Opfer sie bringen können. Zum Beispiel diese Geschichte von einer Frau, die für den Widerstand im Zweiten Weltkrieg aktiv war. Sie bekam den Auftrag, eine Mine in die Stadt zu schmuggeln. Das war gefährlich, weil die Leute an den Kontrollpunkten durchsucht wurden. Und was tat diese Frau? Sie nahm ihr Neugeborenes und versteckte die Mine unter dem Kind. Man hätte sie auf der Stelle töten können, wenn man die Mine gefunden hätte, aber irgendwie, wie durch ein Wunder, kam sie durch. Man kann sich das Ausmaß dieses Opfers vorstellen. Selbst heute, nach allem, was geschehen ist, ist das schwer vorstellbar, aber die Menschen sind zu so etwas fähig. Und wenn man mir sagt, ich sei eine Katastrophenschreiberin, dann bin ich damit nicht einverstanden. Ich sammle den menschlichen Geist. Wie bleibt ein Mensch ein Mensch, wozu ist er fähig, wie kann er den Menschen in sich retten? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Und über die habe ich auch mit Adamowitsch gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich der Realität annähern kann, wie man sicherstellen kann, dass man sich nicht so sehr von der Propaganda abhängig macht, von irgendwelchen Irrlehren, die in einer Zeit vorherrschen. Das ist der Anstoß, den mir mein Lehrer, diese große Persönlichkeit der Literatur, gab. Es ist die Frage, um die es geht: Wirst du versuchen, über das Leben zu sprechen, wie es ist?




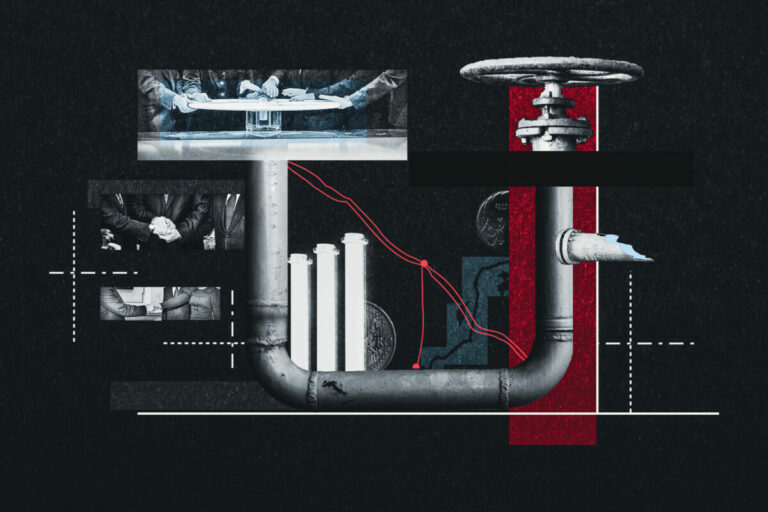




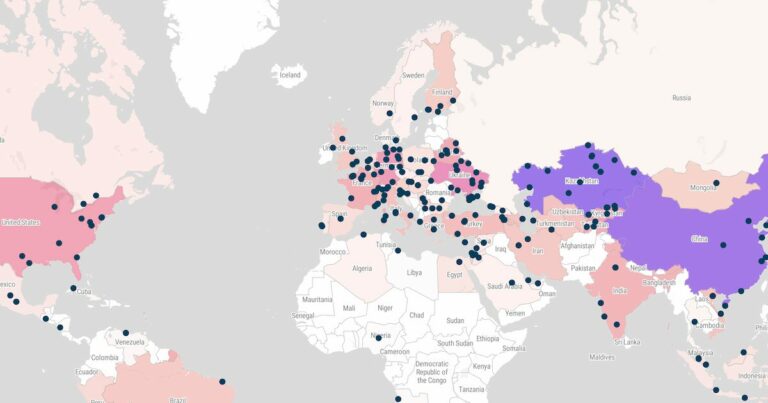





































![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)










