Libido

lllja Sin wurde 1978 in Minsk geboren. In Belarus ist er, der mit bürgerlichem Namen Illja Swiryn heißt, vor allem als Performance-Künstler bekannt. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wirkte er in den avantgardistischen Künstler-Gruppen Bum-Bam-Lit und Schmerzwerk mit. Der Schriftsteller Alhierd Bacharevič erinnert sich in seinem Buch Meine Neunziger an Sins Performances: „Illja verdoppelte sich, er vervielfachte sich, du sahst an seiner Stelle plötzlich die unterschiedlichsten Menschen, die Schauspieler seines Stücks – du erkanntest sie, fandest aber den Menschen nicht mehr, den du, zumindest schien es dir so, kanntest. Illja Sin war ein Rätsel – talentiert, furchterregend und unerreichbar.“
Sin, der streng gläubig ist, veröffentlichte vor allem Kurzprosa und Theaterstücke, als 2018 sein erster Roman erschien. Libido ist nach Sins eigener Aussage sein „erster Prosatext mit einem Helden und einer Handlung“, die der Klappentext so beschreibt: „Maryja lebt in einer provinziellen, postsowjetischen Stadt, deren Bewohner in ihren Einraumwohnungen isoliert sind – mit ihren Erinnerungen, Traumata und künstlichen Geliebten. Irgendwo an der Peripherie ihres Bewusstseins entzündet sich langsam ein Bürgerkrieg, doch bislang nimmt niemand ihn wahr. Maryja hat eine Vorahnung: Bald wird etwas geschehen …“
Der Roman wurde 2019 mit dem Jerzy-Giedroyc-Literaturpreis ausgezeichnet. Der Schriftsteller Jáchym Topol zeigte sich begeistert von der der tschechischen Übersetzung, die 2022 erschien: „In letzter Zeit bin ich selten inspiriert oder überrascht von literarischen Werken. Aber dieses Buch begeistert mich. Es ist einerseits grausam, andererseits voller feinem Humor – sehr spezifisch, mit Elementen von Science Fantasy. Die Handlung spielt in einer nicht genau bezeichneten osteuropäischen Stadt, die Protagonistin ist eine ehemalige Prostituierte … Auch der Stil ist einprägsam – eine sehr sparsame Sprache, aus der Energie atmet …“
Auf dem Herd kocht das Nudelwasser. Die anderen Bestandteile des bescheidenen Abendessens liegen auf dem Küchentisch bereit – ein Stück Schmelzkäse und ein einsames Würstchen. Außerdem noch eine halbe Zwiebel von gestern und ein trockener Brotkanten.
Alle Elemente dieses Stilllebens verkörpern die Zwecklosigkeit jeglicher Bewegung. Genau wie die Landschaft vor dem Fenster: überall die gleichen zerschrammten Plattenbauten, wie das Haus, in dem auch Maryja wohnt. Jeder Block hat eine eigene Nummer, mit roter Farbe aufgemalt, wie die Ziffern auf dem Herz an der Häftlingskleidung .
Maryja scheint es oft, als sähen diese Häuser aus der Vogelperspektive aus wie im Sandkasten vergessenes Spielzeug: Die Kinder sind längst groß, trinken Bier und schnüffeln Leim, haben ihren Berufsschulabschluss, sind verheiratet und wieder geschieden, das Spielzeug aber liegt noch immer im Sandkasten, allerlei Naturgewalten ausgesetzt. Wie das unerschütterlichste und unpassendste Sinnbild für die Stabilität der Welt.
Es ist Ironie des Schicksals, dass diese Fünfgeschosser hier einst als die Vorzeichen einer Bewegung auftauchten, die sich durch geschwinde und gedankenlose tierische Vitalität auszeichnete. Die Stadt wuchs in fast biblischem Tempo. Am Montag erschienen die Baugruben neuer Fabriken, am Dienstag wuchsen Neubaugebiete aus der Erde empor, am Mittwoch Geschäfte und Kulturhäuser, und am Samstag steckten die Milizionäre bereits den ersten örtlichen Säufer in den Knast, der die Rückseite der frisch gestrichenen Ehrentafel mit Urin besudelt hatte – an der just am Sonntag die ersten Porträts der Bestarbeiter aufgehängt werden sollten.
Nachdem sie ihr Werk vollbracht hatte, zog die Bewegung irgendwohin weiter und ließ eine unumkehrbar zerstörte Landschaft und ein paar Hunderttausend verwirrte Bewohner zurück, die noch immer erfolglos versuchen zu verstehen, wie und wozu sie hier gelandet sind.
Maryja ist nicht hier geboren. Vor fünf Jahren hatte sie diese Stadt ausgewählt, indem sie mit dem Finger ins Telefonbuch tippte. Denn sie musste irgendwohin, irgendwo leben.
[…]
Maryja mag es, die Blütenblätter von Kunstblumen abzubrechen und darauf herumzukauen, auch wenn sie nicht gerade gut riechen. Immer wieder schiebt sie die Hand in die Tasche, nimmt ein Stück und steckt es in den Mund, wie ein kleines Kind. Die Zähne halten die Ränder, die Zunge fährt geschmeidig über die unregelmäßige Oberfläche und erfasst die vielen Erhebungen.
Diese Beschäftigung ist angenehm und eine gute Rettung vor den Dämonen der Vergangenheit, die besonders zu dieser Tageszeit versuchen, Maryja in ihren Strudel anlassloser Erinnerungen zu zerren.
Bewegung und das Empfinden von Schmerz und Geschmack sind genau das, woran es Maryja chronisch mangelt. Aber es hilft nicht lange, schon bald kauen Maryjas Kiefer nur noch im Leerlauf, versorgen das Bewusstsein nicht mehr mit neuen Eindrücken. Angewidert spuckt sie den verunstalteten Plastikklumpen aus.
In solchen Momenten möchte sie oft einfrieren, in einer möglichst natürlichen Position erstarren – wie auf einer viktorianischen Post-Mortem-Fotografie. Es gelingt ihr, und sie misst die Minuten. Das Maximum liegt bei zwölf, kein schlechtes Ergebnis.
Dann passiert etwas im Hof, jemand telefoniert oder hupt. Maryja kehrt ohne besonderen Antrieb in die Welt der Lebenden zurück, um sich einmal mehr davon zu überzeugen, dass dort nichts geschieht.
Die Zwischenzeit, wenn der Schnee sich noch in der Luft in Wasser verwandelt.
Die Zwischensprache, wenn das erzwungene Schweigen nicht in Worten aufgeht, im Hals steckenbleibt wie Blütenblätter von Plastikrosen.
Die Zwischenstimmung, wenn weder Aufregung noch Ruhe zugänglich sind, weil sie in die dünne Plastikfolie der Gleichgültigkeit gewickelt sind.
Vor fünf Jahren spürte Maryja zum ersten Mal, dass ihre Geschichte zu Ende war.
Vor fünf Jahren wurde Maryja klar, dass sie nicht mehr Madame Brik, Xuscha Luzik oder Krankenschwester Taja war. Seither ist sie wieder Maryja. Ganz und gar, endgültig und unumkehrbar.
Wahrscheinlich hatte an jenem Tag jemand fein säuberlich das letzte Blatt Papier in ihre Akte geheftet, die von der Anstrengung feucht gewordenen Handflächen leicht abgewischt, die Krawatte zurechtgerückt, mit den rauen Fingern die Nase gekratzt, die Akte geschlossen und die Bändchen verschnürt. Die Arbeit für heute war getan, jetzt konnte die Akte ins Archiv und man selbst raus an die frische Luft.
In dieser Akte waren das Scheinwerferlicht, die Lederaccessoires, Doppelpenetration und die durchdringenden spitzen Schreie, die bei Maryja ganz natürlich wirkten. Das war dort alles vermerkt, neben den anderen wichtigen Angaben, die in bestimmten Formularen nicht fehlen durften.
Jetzt sind sie völlig belanglos. Es gibt nur die schmutzige Wohnung, den juckenden Schmerz im Intimbereich und die Plastikblütenblätter.
Maryjas neue Geschichte hat es jedoch immer noch nicht eilig damit, zu beginnen.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass der dafür verantwortliche Sachbearbeiter nicht verantwortungsbewusst genug war, denkt sie. Er beendete seine Arbeit, ging heim, hängte seinen strengen Anzug in den Schrank, richtete das Jackett an den Schultern ordentlich aus, zog die abgewetzte Sporthose an, aß Pelmeni und fiel dann aufs Sofa, um fernzusehen.
Unwahrscheinlich, dass er eine Frau hat, denkt Maryja aus irgendeinem Grund.
Auf dem Bildschirm läuft Fußball, das Spiel kommt nicht in Gang, und er schaut aufmerksam zu, wie die Spieler den Ball planlos von einem Ende des Spielfelds zum anderen jagen. Es steht 0:0.
Plötzlich klingelt das Telefon, aber der Mann steht nicht vom Sofa auf. Er verfolgt fasziniert den Spielverlauf, und mit der Zeit fällt seine Atmung immer mehr in den Rhythmus der Ereignisse. Auf die Atmung folgt der Kreislauf und dann der Stoffwechsel.
Die eintönigen Bewegungsabläufe wiederholen sich immer und immer wieder, selbst nach Ende der regulären anderthalb Stunden Spielzeit. Die Fußballspieler der einen Mannschaft laufen auf das Tor des Gegners zu, dann, im scheinbar spannendsten Moment, verlieren sie (absichtlich?) den Ball, und die Bewegung beginnt von Neuem, nun schon in die andere Richtung.
Das Spiel endet auch dann nicht, als sein Zuschauer plötzlich an Herzstillstand stirbt, oder an Harnblasenruptur oder schlicht an Hunger.
Im Büro bemerkte man die Abwesenheit des Sachbearbeiters gar nicht. Die Kollegen warfen seinem Arbeitsplatz weiterhin das gewohnte „Mahlzeit“ hin, auf dem Tisch landeten noch immer Akten mit Geschichten von solchen wie Maryja, und die Betriebsfeier zum Firmenjubiläum endete in einem solchen Alkoholdusel, dass es ein Leichtes war, in diesem Nebel den Verlust eines Kämpfers zu übersehen.
Zumal doch jeder seine eigene Geschichte hat, und niemand sie aus freiem Willen teilen möchte.
Derweil zerfiel der Sachbearbeiter langsam auf seinem Sofa. Die Nachbarn, besorgt über die unangenehmen Gerüche, hatten schon einmal fast die Polizei angerufen. Doch da aus der Wohnung noch immer die Fußballspielgeräusche drangen, beschlossen sie, dass alles seine Ordnung habe – wahrscheinlich war nur der Tomatenvorrat auf dem Balkon vergammelt.
Dann kam der Winter, es fiel Schnee, und alle hatten sowieso anderes zu tun.
Aus der schier unbegrenzten Anzahl von Varianten, warum Maryjas neue Geschichte partout nicht beginnen wollte, gefällt ihr selbst genau diese Version am besten.
Das nächste Blütenblatt schmeckte irgendwie bitter.
[…]
Maryja schläft oft an den ungewöhnlichsten Orten ein: im Bus, beim Anstehen nach Brotcoupons, während eines Gesprächs mit irgendwelchen Halbbekannten und einer zufälligen Schnapsflasche im Park.
In diesem Moment sagt Maryja: Ich bin der Traum. Ich bin ganz Traum. Oder, genauer, ich bin das Träumen, denn es geht nicht um das Phänomen, sondern um den zähen, langsamen Prozess. Als würden Linsen eine nach der anderen unter dem Deckel eines Wundertopfes hervorspringen und alle Fliegen in der Umgebung zwingen, in der Ekstase eines seligen Todes zugrunde zu gehen.
Träumen ist ein Prozess. Die schrittweise Änderung der Körpertemperatur, der inneren Farben, des Tastsinns.
Der Laternenmast scheint ihr wie aus Plastilin. Ebenso der Asphalt unter ihren Füßen, dem sie jetzt eine gefällige Form geben kann, wenn sie mit der Schuhspitze hineindrückt. Das Gesicht des Milizionärs ist ebenfalls aus Plastilin, man muss es anfassen, um es zu verstehen.
Im Traum formt sie aus dem allgegenwärtigen Plastilin gern wundersame Figuren und verändert so nach und nach das Antlitz der Welt.
Durch den schweren Leib des Mannes in Lederjacke und Mütze kann man, so scheint es, sogar ganz und gar hindurchgreifen.
Maryja kann schlafen, ohne die Augen zu schließen, ohne ein fades Gespräch zu beenden, ohne das Glas abzustellen.
Der Traum fließt durch ihre Adern wie eine leichte, ätherische Substanz, die das schwer gewordene Blut ersetzt.
Manchmal kommt es ihr im Traum so vor, als sei ihre Haut ganz dünn geworden, abgewetzt, fast löchrig. Als würde nur ein klein wenig mehr ausreichen, und alles, was in ihr ist, würde herausfallen.
Manchmal sammelt sie im Traum sogar ihr eigenes Innerstes vom Fußboden auf und stopft es mit unschuldigem Lächeln zurück – wie Lippenstift oder Wimperntusche, die aus der zerschlissenen Kosmetiktasche gefallen sind. Und wundert sich darüber, wie leicht und luftig Lungenflügel sein können.
Im Traum gelangt sie immer an einen sicheren und behaglichen Ort. Das Bächlein im Wald, mit moosbewachsenen Ufern, in dessen Umarmung sie sicher niemand verletzen wird. Der Ofen des verlassenen Krematoriums, in dem man bequem die Beine ausstrecken kann, nachdem man sich in eine warme Decke gewickelt hat. Der gut ausgestattete Schutzraum neben der Fernwärmeleitung im Hausaufgang, der wie eine Rettung erscheint nach einer Reihe vorangegangener Ereignisse – die aus irgendeinem Grund nicht betrachtet werden.
Oft scheint es ihr, als sei ihr Körper von Flüssigkeit umgeben – ein wenig klebrig, aber angenehm und warm. Dort fühlt sie sich so wohl, wie im Mutterleib.
Maryjas Traum ist hartnäckig, schwierig loszuwerden. Entschlossen schiebt er die hässliche Wirklichkeit beiseite (Schmelzwasser unter den Füßen, grobe Rufe am Kontrollposten, jemand stößt sie an der Schulter mit seinem schon wieder du Junkie).
In diesen Momenten flüstert Maryja: Ich bin der Traum. Oder genauer, ich bin das Träumen, wenn man nicht das Phänomen betrachtet, sondern den Prozess.
Der Traum setzt seine Akzente der Wahrnehmung, und die krummen Schatten der Zweige, die über den rauen, grauen Asphalt wandern, scheinen ihr nicht weniger bedeutungsvoll als die heute gehörte Nachricht vom Beginn einer Spezialoperation.
Im Traum erhalten die Regentropfen, die an der Scheibe herablaufen, plötzlich eine höhere Bestimmung. Und die ewige Frage „Wozu?“ wird zum bloßen Geraschel bunter Zettelchen an den Stäben eines Ventilators.
Der Traum ist fähig, märchenhafte Bilder zu weben, der Traum gebiert das leichte Verlangen, das die bewusstlose Prinzessin genau am Vorabend des langersehnten Kusses des Prinzen ergreift.
Manchmal lockt der Traum die Nadeln des grundlosen Glücks hervor, deren Stiche einen noch lange unwohl machen, wie nach einem Rausch.
Aber das Interessanteste im Traum ist der Tod. Von einem Wolkenkratzer zu fallen, mit dem Motorrad frontal zu kollidieren, allmählich und offensichtlich unumkehrbar in den Tiefen des Wassers zu ertrinken. Fruchtloser Kampf, Gefühl der Verzweiflung, Krampfanfälle …
Maryja liebt es zu sterben, es gelingt ihr sehr oft und recht einfallsreich. Der Tod weckt wenigstens für kurze Zeit die eingefrorenen Nervenzellen. Der Tod scheint ihr die beste Attraktion im Leben zu sein.
[…]
Ohne sich auszuziehen, wirft Maryja sich aufs Bett, in die schmutzigen Laken, die sie nie wechselt. Müdigkeit macht sich aus irgendeinem Grund viel stärker bemerkbar als Hunger. Müdigkeit ist wie ein ungeduldiger Mann, er überfällt sie, überwindet mit Leichtigkeit den schwachen Widerstand und ergreift Besitz von ihr.
Die Wohnung liegt bereits im Halbdunkel, aber Maryja schaltet das Licht nicht ein. Kleine Windböen heben die Vorhänge, und das Scheinwerferlicht zufälliger Autos dringt ins Zimmer.
In der Nachbarwohnung schaut Dsima Fußball. Eine Etage höher ist Geschirrgeklapper zu hören. „Ach, lass es, ich will deine Buletten nicht. Hast wieder ohne Ende Weißbrot reingetan.“
Maryja dreht sich vom Rücken auf den Bauch und presst ihr Gesicht ins Kissen. Sie schließt die Augen. Angenehme Bewegungslosigkeit.
Sie würde gern ein Lied für ihn singen, und stellt sich vor, wie das Lied sie verbindet, wie es ihre Körper durchbohrt und zu einer Einheit macht.
Maryjas Körper scheint ihr jetzt schon nicht mehr so monolithisch, wie sonst. Poren, durch die Luft dringt, öffnen sich. Sie kann mit ihrem Körper das Halbdunkel spüren, das im Zimmer herrscht, die Ranken der Pflanzen auf dem Fensterbrett und selbst den Regen, der erst in einigen Minuten draußen einsetzen wird. Jetzt kann sie mit ihrem Körper singen.
Und da erklingt in ihrer Phantasie schon das Lied. Auch er ist in ihrer Vorstellung da, und das Lied zwingt ihn anwesend zu sein. Sie ist sogar fähig, dieses Lied in seiner Phantasie zu hören.
Und es ist nichts Schlimmes dabei, dass das Lied vom Tod handelt.
Maryja möchte dieses Wort auf die Art der Musik sagen, es langziehen mit ihrem schönen Sopran, mit dem sie auch nur in ihrer Phantasie gesegnet ist.
Der Tod war zu allen Zeiten das beste Thema für Lieder.
Der Tod ist gar nicht ihre jetzige Realität.
Der Tod kommt nur in sumerischen Legenden und präraphaelitischen Gemälden vor.
Der Tod wird nie in ihre Einraumwohnung kommen, zu der verblichenen Blumentapete und dem Linoleumfußboden in der Küche, der aufgequollen ist, von Tränen, wie ihr scheint.
Hier, in den gleichermaßen zerschrammten Fünfgeschossern, kann es einfach keinen Tod geben. Hier gibt es polnische Sanitärtechnik und Eurorenovierung. In jeder Wohnzelle glimmt ein eigenes Leben, hübsch von innen, aber unendlich öde für den entfremdeten Blick des Betrachters.
Der Tod war ihr immer wie eine Art Wesensmerkmal der Zeit erschienen, aber hier stand die Zeit still, wie Stücke von Dosenfleisch in einem vergessenen strategischen Feldlager.
Maryja vermochte nun aber die Zeit zu spüren, allerdings keineswegs als Unausweichlichkeit oder Imperativ. Aber auch überhaupt nicht als Tod.
Plötzlich werden Nylonstrümpfe zu ihrer Jetztzeit, ausgezogen nach einem mit Eindrücken gefüllten Tag und abgelegt auf der Kante eines Hotelbetts, dessen Knitterfalten angenehme Erinnerungen wecken. Oder die Rührung, als sie im Park inmitten dieser riesigen Stadt plötzlich einen Igel sah. Oder dieses eine Mal, als sie gebeten wurde, ein fünf Monate altes Mädchen ein wenig auf dem Arm zu halten, und das Baby es dann schaffte, auf Maryjas Kleid zu pullern.
Maryja möchte in jeden dieser Momente eintauchen und ihn für immer zu ihrer Wirklichkeit machen. Als würde sie den Film an der angenehmsten Stelle auf Pause stellen – bevor sich der dramaturgisch unausweichliche Konflikt ereignet.
Die Einsicht, dass das unmöglich ist, überrollt sie wie eine Zementlawine. Mit ihren abgekauten Fingernägeln bohrt Maryja in der dünnen Haut ihres Handgelenks.
Dann steht sie vom Bett auf, geht aus irgendeinem Grund ins Wohnzimmer, geht wieder zurück, schaltet den Fernseher ein und drückt immer wieder auf der Fernbedienung herum, als sie auf jedem Kanal Bilder ihrer Nichtheimatstadt sieht. Schließlich landet sie beim Wetterbericht auf Euronews und hört sich fügsam an, wie viel Grad morgen in Montevideo und in Beirut sein werden.
Dann schaltet sie den Fernseher aus und legt sich wieder ins Bett. Dann steht sie wieder auf, um das Geschirr von Vorgestern zu spülen, tritt aber stattdessen mit aller Kraft gegen eine leere Bierflasche, die mitten in der Küche herumsteht. Dann schaltet sie den Fernseher wieder ein und der zerschmettert die Luft mit den unheilvollen Klängen eines Schlaflieds.
Die Poren in Maryjas Körper schließen sich langsam, wie Tarnklappen vor Maschinengewehrschießscharten, und schon bald kann sie gar nichts mehr empfinden.
Maryjas Körper ist ihre Hülle, die sie schützt und behütet.
Die Übersetzungen dieser Texte und die Veröffentlichung im Rahmen des dekoder-Specials Durch die Nacht, durch den Sturm – Literatur aus Belarus entstanden mit freundlicher Unterstützung des Goethe-Instituts im Exil, das 2024 einen Länderschwerpunkt Belarus präsentiert.
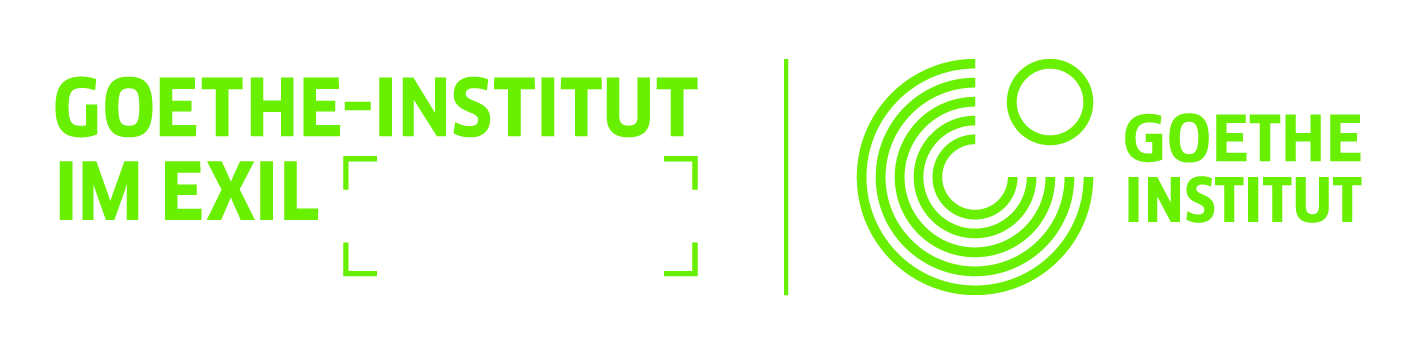


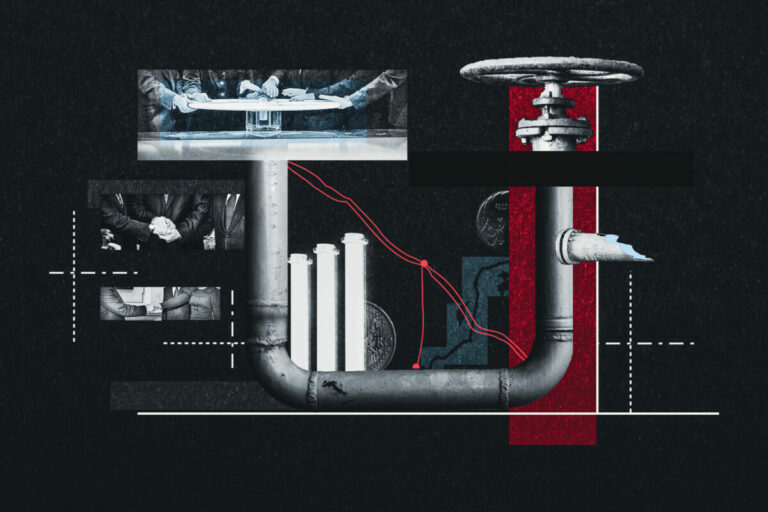




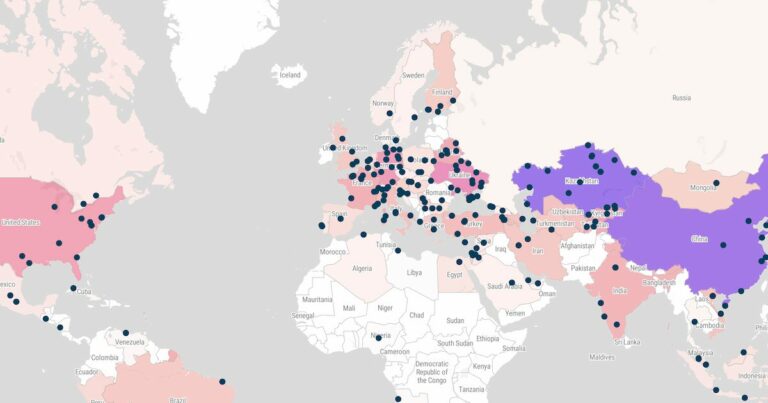





































![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)










