Der Elefant

Uladsimir Adamtschyk, 1958 in der belarussischen Kleinstadt Dsjarshynsk geboren, ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der belarussischen Kultur. Sein Vater war ebenfalls Schriftsteller, so dass Adam Hlobus, wie er sich später nannte, bereits in jungen Jahren mit Künstlern und Literaten in Kontakt kam. Nach dem Abschluss der Kunsthochschule studierte er an der Belarussischen Universität für Theater und Künste in Minsk und arbeitete anschließend als bildender Künstler und Restaurator.
Von 1986 bis 1990 war er Mitglied der jungen Schriftstellervereinigung Tuteischyja, dessen Vorsitzender damals Ales Bjaljazki war. Die Gruppe mischte die belarussische Literatur stilistisch und thematisch auf, sie experimentierte mit Genres wie Comic und Detektivgeschichten, wandte sich vom klassischen Topos des Dorfes ab und dem urbanen Leben zu. Zudem waren diese jungen Autoren zivilgesellschaftlich aktiv, so waren sie auch an der Organisation des ersten Dsjady-Marsches nach Kurapaty im Jahr 1988 beteiligt. Die Gruppe und damit auch Adam Hlobus waren prägend für die nachfolgende Generation von belarussischen Literaten.
Adam Hlobus schreibt auf Belarussisch. Seit seinem Buchdebüt Park im Jahr 1988 hat er über zwei Dutzend Bücher veröffentlicht, mit Kurzgeschichten, Märchen sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, und autobiografischen Erzählungen. Er gilt als thematischer Wegbereiter der Erotik in der belarussischen Literatur.
Die hier erstmals ins Deutsche übersetzte Kurzgeschichte Der Elefant wurde im September 1985 in der Jugendzeitschrift Tschyrwonaja smena (dt. Rote Wende) veröffentlicht, sie fand später Eingang in den Prosaband Adsinota u stadione (dt. Einsamkeit im Stadion). Es ist Hlobus‘ erste Kurzgeschichte überhaupt und gründet auf tatsächlichen Erlebnissen der Minsker Jugend in den 1980er Jahren.
Ich laufe über den rauen Asphalt durch die abendliche Stadt. Die Straße dampft vor Hitze. Zwischen zwei Häuserwänden hängt in einem Spalt der rote Sonnenklumpen. Schon seit einem Monat gehe ich nach dem Unterricht an der Kunsthochschule immer in den kleinen Park, um in der Dämmerung einen Elefanten zu bauen. Dieses Geschöpf aus Draht und allerlei anderen Schätzen, die ich auf Müllplätzen finde, soll den Park verschönern.
Im Klappern der Absätze höre ich die Frage: „Warum baust du einen Elefanten?“ Eine Antwort habe ich, aber sie endet nicht mit einem Ausrufezeichen, nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Fragezeichen. Warum fährt jemand mit einem Stab über den Lattenzaun? Warum tritt jemand mit dem Fuß gegen eine leere Blechdose? Warum wirft er, wenn er am Wasser steht, einen Stein hinein, wenn er es nicht schafft, sich zu fragen: Weshalb mache ich das? Vielleicht lauscht er der Stimme der Bäume, die ihm nun als etwas anderes erscheinen als Zaunlatten? Vielleicht hört er im Klappern der Blechdose ein Blasorchester? Vielleicht … Vielleicht … Aber vielleicht auch nicht?
Mit einem Stück zementverschmierter Dachpappe, gefunden auf einer Baustelle, betrete ich den Innenhof einer Hochhaussiedlung. Ich will schauen, ob es bei den Müllcontainern vielleicht ein wenig Draht gibt. Zwei Stuhllehnen sind die ganze Ausbeute. Am nächsten Hof könnte ich getrost vorbeigehen – dort waltet ein wachsamer Hausmeister. Ich schaue trotzdem hinein.
Auf den Containern treiben sich Katzen herum. Jede hat ihren eigenen Container. Als ich näherkomme, springen die Katzen mit faulen Pfoten herunter und verlassen gemächlich den Ort, als hätten sie nichts mit dem ganzen Dreck zu tun. Meinen eigenen Beobachtungen nach erinnern die Katzen stärker an Müll als mein Elefant. Draht gibt es nicht. Dafür eine Blechbüchse, in der einmal Kaffee war. Weiter … Weiter … Drei Müllplätze, und kein einziges Geschenk des Schicksals. Endlich finde ich verrosteten Eisendraht. In der Tasche drücke ich die Zange zusammen. Ich habe sie nicht vergessen – also kann der Draht mitkommen. Wäre er aus Alu oder Blech, bräuchte ich keine Zange, aber bei Eisen geht’s nicht ohne.
Wenn ich die Hauptstraße entlanglaufe, drehen sich die Menschen um und lachen. Wenn ich aber diese schmale, baumlose, rot-schwarz-graue Gasse durchquere, erschrecken sie, gehen auf die andere Seite, tun so, als bemerkten sie mich gar nicht.
Endlich der kleine Park. Mein Park, in dem es keinen einzigen asphaltierten Weg gibt, weswegen ich ihn so mag. Er erinnert an einen Ausschnitt aus einem Filmplaneten, auf dem der Elefant leben soll. Bevor ich begann, den Elefanten zu bauen, malte ich lachende Sonnen an Hauswände, aber sie wurden nicht abgewaschen, nicht übermalt, und deshalb musste ich jedes Mal eine neue Wand finden. Ich hatte genug von der Suche und fand dann auf meinem Schaffensweg den Park. Eigentlich war er nur der Bezeichnung nach ein Park. Einige Dutzend Bäume, von zwei Seiten von einer Ziegelmauer eingefasst, dann der Fluss und auf der dritten Seite eine enge Straße, über die Straßenbahnräder ratterten. Das erste, was ich im kleinen Park schuf, war der Schriftzug „Wowa“ mit Kreide an der roten Fabrikwand, und eine lachende Sonne.
Ich ordne meine Schätze auf der Wiese, dann gehe ich zum Fluss. Ich muss Röhricht abreißen, um den Elefanten grün zu machen. Wie immer füllt sich ein Stiefel mit Wasser. Warum immer nur einer? Und ich putze dann zwei? Weiß der Teufel. Scheiß auf den Stiefel. Ich muss schnell den Elefanten bauen.
Ich arbeite schon seit einer halben Stunde. Drahtgeflecht und Stuhllehnen verbinde ich zu einem Gerüst, bedecke es mit Grasnarbe, die ich am Ufer abgestochen habe. Es entsteht ein schemenhafter, dunkelgrüner Buckel, dessen Silhouette an einen Elefanten erinnert. Ich bedecke die Skulptur ringsherum mit Rohrgras, und es entsteht ein welliger Elefant in saftigem Grün. Jetzt fehlen nur noch Kleinigkeiten – Ohren und Augen. Die eine Blechdose ist von einer Kaffeefirma, in der anderen waren Sprotten, die Augen werden also unterschiedlich. Mit einem Stock durchbohre ich den Elefantenkopf an der Stelle, an der die Augen sein sollen, breche die Enden ab, so dass er auf jeder Seite fünf Zentimeter herausragt, und stecke die Dosen darauf. Der Elefant ist ein bisschen glotzäugig, aber das stört mich nicht. Ich male mit Kreide einen Umriss auf die Dachpappe, und reiße dann vorsichtig entlang der Linie ab. Ich hätte auch schneiden können, aber mir gefallen die gerissenen Konturen der Ohren. So sehen sie lebendiger aus. Aus Stöckchen mache ich Dübel und befestige die Ohren am Kopf. Fast hätte ich die Stoßzähne vergessen. Am Ufer breche ich einige Haselnusszweige ab, schäle die Rinde ab, und schon komplettieren Stoßzähne meinen Elefanten mit Rüssel und Schwanz aus Röhricht.
Zufrieden mit dem vollendeten Werk wasche ich Stiefel und Hände, setze mich auf die Bank, so, dass ich den Elefanten sehen kann, und zünde mir eine Zigarette an.
Soweit ich meine Stadt kenne, lebt in ihr nur ein Elefant, und der existiert von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Mehr Elefanten gibt es nicht, und wenn es keine gibt, dann soll das auch so bleiben. Vielleicht sollte es überhaupt keine Elefanten geben? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht … Aber irgendwie muss ich diesen Elefanten bauen, und tue das in dem kleinen Park am schmutzigen Fluss, dessen Grund voller rostiger, verbeulter Blechdosen ist. Warum einen Elefanten, keinen Löwen oder kein Pferd? Weil ein Elefant einfacher ist. Durch den Rüssel und die großen Ohren erkennt man leicht, dass es eben ein Elefant ist, kein Pferd oder Löwe. Und warum nur von 21 Uhr bis 6 Uhr? Das ist eine schwierigere Frage …
Hier kommt auch schon die Ursache dieser Zeitbeschränkung – der Straßenkehrer. Ein rotwangiger Junge in Jeans und Samtkappe, in dessen Augen zwei trübe, scheinbar versteinerte Sonnen leuchten. Er schimpft auf mich, auf den Elefanten und die ganze weite Welt. Ihm passt es nicht, wenn es regnet, ihm passt es nicht, wenn es nicht regnet und der Wind Staub und Dreck auf sein Areal fegt. Ihm passt es nicht, wenn es schneit, und auch nicht, wenn es nicht schneit, denn dann gibt es Glatteis. Es ist ein Schimpfen von Berufs wegen, jeder echte Straßenkehrer beginnt seinen Arbeitstag damit, denn jedes Naturphänomen birgt in seinen Augen ein Schmutzpotenzial. Der Straßenkehrer ist ein Kämpfer für die Sauberkeit! Dieser hier trägt immer eine rot-gelb-karierte Jacke, weshalb ich ihm den Spitznamen Blätterfall gab.
Der Elefant stört, es lässt sich nicht ruhig leben mit ihm. Blätterfall kann wahrscheinlich nicht schlafen wegen meines Elefanten. Ich stelle mir vor, wie sich der Straßenkehrer im Bett herumwälzt, ächzt, im Schlaf mit dem Elefanten ringt. Der wirft sich auf ihn, wie der Drache auf den dummen Iwan. Und Blätterfall, in einer Hand den Besen, in der anderen die Schaufel, kämpft sich mit letzter Kraft frei und schlägt am Ende dem Elefanten-Drachen den grünen Kopf ab. Kichernd geht Blätterfall-Iwan-Dummkopf unter die Brücke und legt sich im Schilf schlafen … Dem hast du es gegeben, gesiegt hast du. Hurra! Hurra! Ich werde dich nicht bedauern, Bruder Blätterfall. Werde nichts auf deine Beschwerden über den Elefanten und das Wetter geben. Und morgen werde ich wieder einen Elefanten bauen, mit einem Schwanz, so lang wie der Rüssel. Schade, dass der Straßenkehrer anderer Auffassung ist. Jeden Morgen vernichtet er das Monster, auch wenn es mit schmerzerfüllten Augen auf den Besen starrt.
Ich rauche meine Zigarette auf, werfe die Kippe in den Mülleimer, unterstreiche damit meine Liebe zur Sauberkeit. Ich stehe auf und mache mich auf den Heimweg. Oh, Mist, die Zange vergessen! Ich kehre um, um sie holen. Der Elefant steht noch da, die Zange liegt daneben. Ich nehme sie und stecke sie ein. Gehe nach Hause. Immer, wenn ich den Elefanten verlasse, denke ich an die Nacht, an die Endlosigkeit des offenen Raumes, an die Einsamkeit, die mich umgibt … Auf den Wogen der Einsamkeit schaukelt wie ein Papierboot die Seele. Ein solches Bild der Seele gefällt mir, es beruhigt. Das Papierboot, gefaltet aus einem reinweißen Blatt Papier, so sauber, dass es blau strahlt, auf dem dunkelbraunen Wasser, und die Abwesenheit der Spiegelung, einer Spiegelung der Seele. Ich schaue in den Himmel und bleibe überrascht stehen – über mir hängt statt des Mondes das weiße-weiße Papierboot. Nein, ich muss das Bild von der Seele ändern. Das Boot verwandelt sich langsam in ein einfaches Viereck.
Zuerst ändere ich die Farbe, mein weißes Boot wird grün, dann wird es rot auf schwarzem Wasser und schließlich schwarz auf rotem Wasser. Und warum eigentlich ein Boot? Meine Vorstellung macht aus ihm eine Blechdose, die dem Auge des letzten Elefanten ähnelt. Meine Gedanken schweifen schon ab, als mir ein Bild einkommt: Die Seele ist ein Wassertropfen. Nur zeigt nicht die schwere Seite nach unten, sondern umgekehrt. Der Vergleich der Seele mit dem Tropfen, der mit dem spitzen Ende zum Mittelpunkt der Erde zeigt, stoppt meine Phantasie. Ich denke wieder an den Elefanten. Wie sieht seine Seele aus? Hat er überhaupt eine? Oder haben wir beide eine gemeinsam? Ist dieses unästhetische Monster mit Stöcken statt Stoßzähnen vielleicht ein Abbild meines Geistes?
Ich schlafe ein mit dem Gedanken, dass morgen die Sonne scheinen wird. Die Sonne wird aufgehen, ob du stehst, oder fällst – sie wird da sein. Wie wird sie sein? Das weiß ich nicht. Niemand weiß das nur der Morgen selbst. Ich schlafe ein und hoffe, dass es eine Elefantensonne wird, denn ich muss an einen Container denken, aus dem ich fingerdicken Aluminiumdraht ziehe, um die Sonne morgen zum Elefanten zu machen.
Die Stadt schläft.
… Ich stehe auf dem Balkon (im Traum), schaue in den Hof. Plötzlich beginnt unsere hundertmal betrachtete Mülltonne zu singen: „Da ein Berg, und dort ein Berg. Und hinter all diesen Bergen – gar nichts mehr …“ Die Katzen springen von den Containern und flüchten. Es fühlt sich an, als hätte sich in den vier rostigen Müllcontainern eine Rockband versteckt. Das Lied wummert nun an die Hauswände. Es tost und dröhnt. Jeder Akkord bohrt sich wie ein Nagel ins Ohr. Nur eine Frage pocht hinter der Schläfe. Warum wacht niemand auf? Ich will vom Balkon flüchten, aber es geht nicht. Die Tür ist zu und statt der Balkontür sehe ich ein rotes Eisentor, gleich einem meiner Seelenboote. Auf den ersten Blick, und auch auf den zweiten und dritten kann man es unmöglich öffnen. „Da ein Berg. Und dort ein Be-e-erg“ – schreien die Container … Ich schaue hinunter. Wieder etwas Unbegreifliches – die Balkone, die immer unter unserem waren, sind fort. Die Fenster auch. Nur noch Wand. „Da ’ne Wand, und dort ‘ne Wa-a-and …“ Im Schädel kreisen die Gedanken. Dummheit und Verstand sind nicht zu unterscheiden. Die Wand muss durchbrochen werden! Aber wie, wie durchbricht man sie? Wenn sie in jedem steckt, wenn überall Wände sind, auch in mir, auch in meiner Seele eine Wand steht – endlos, grau, verputzt, rau, kalt, ungenießbar … Ich spüre, wie mich jede physische Kraft verlässt. Meine Hände machen, was sie wollen. Sie brechen einander, um durch den physischen Schmerz an der Geisteskraft zu rühren. Die Seele aber bleibt unbewegt, sie folgt nicht, sie hört nur zu, ohne zu fühlen. Von der Endlosigkeit der Wände erstarrt, schweigt sie. Die Wände beginnen zu schwanken. Der Balkon erzittert. Die Container öffnen sich, aus ihnen ergießt sich der Müll. Er wächst in viereckigen Säulen nach oben, erreicht das erste Obergeschoss. Die Säulen überkreuzen sich, vereinigen sich zu einem vierbeinigen Monster. An zwei Seiten wachsen dicke Schläuche daraus hervor, wie bei einem Jauchewagen. Das ist ein Elefant! Ich werde ruhiger. Im Schlauch röchelt es zuerst leise, wegen der noch über dem Balkon hängenden Kakophonie: „Die Wand …“ Der Ton wird stärker. Das „a“ schlägt wie ein Stein auf mein Ohr … Der Elefant regt sich. Erst bewegt er ein Bein, klappert mit dem Containerfuß gegen die Bordsteinkante. Sein Rüssel schlägt gegen das Nachbarhaus. Das Haus fällt in sich zusammen, Schutt und Asche. Durch den Staub hindurch stapft der Elefant auf mich zu. Er zertrampelt Autos wie Blechdosen. Ein Nummernschild bleibt mir in Erinnerung – MY-TOS 007. Keine Ahnung, wozu. Vielleicht wegen der Plausibilität. Der Elefant schlägt mit dem Rüssel gegen mein Haus. Der Balkon neigt sich, ich falle über das Geländer und wache auf …
Im Nachbarzimmer klingelt der Wecker: „Schschsch-bumm-na-a-a …“ Und ich höre den Widerhall aus dem Traumreich: „Wa-a-and …“
Ich stehe auf. Frühstücke nicht. Laufe zum Park. Der Morgen grüßt mich mit einem Zug kalter Luft und dünnem Zellophan von Eis auf den Pfützen. Ein sonniger Morgen, windstill. Der Straßenkehrer flucht und macht sich auf zum Elefanten. Die Weide, hinter der ich mich verstecke, raschelt dumpf, kaum hörbar mit ihrem Laub, das den Blättern von Grabkränzen gleicht, die mit Kerzenwachs übergossen wurden. Ich erwische mich dabei, wie ich ein bitteres, schlecht schmeckendes Blatt kaue. Wenn ich aufmerksam andere Menschen beobachte, vergesse ich mich selbst. Und völlig unerwartet wird mir dann bewusst, dass ich etwas Sinnloses tue. Wie jetzt gerade, als ich dieses Weidenblatt esse.
Am Ufer des graugrün-dreckigen Flusses leuchten die Muster des ersten Eises. Blätterfall trägt Schaufel und Besen. Er tritt zum Elefanten, raucht seine Kippe auf, wirft sie ins Gras. Und mit aller Kraft hackt er mit der Schaufel auf den grünen, glänzenden Rücken des Elefanten. Dann schlägt er am vorderen Teil den Kopf ab, legt ihn auf die Schaufel und trägt ihn zum Fluss. Er wirft ihn ins Wasser, so weit wie möglich weg vom Ufer, hinter das Eis. Kommt zurück, lädt ein Bein und den Röhrichtrüssel auf, geht wieder zum Fluss. Nach sechs Runden hat er den ganzen Elefanten versenkt. Danach sammelt er die Rasenreste auf und tritt sie in die Mülltonne. Pfeift und lächelt, geht zum anderen Ende des Parks und beginnt seinen üblichen Arbeitstag. Ich trete hinter der Weide hervor und schaue auf den Fluss. Das Wasser schaukelt, darauf schwimmen Wasserpflanzen, vermischt mit rostigem Draht und anderen Überbleibseln meines Elefanten. Auf dem weißen Eis dunkelt die Fußspur des Straßenkehrers nach. Über den ganzen Park, bis zu den Straßenbahngleisen, rufe ich: „Guten Morgen, Blätterfall!“ – und gehe in Richtung Hochschule, dem Park bleibt nur das Echo meiner Schritte.
Abend. Ich baue einen Elefanten aus einer braunen Nylonjacke, die ich auf einer Baustelle gefunden habe. Der synthetische, an den Taschen speckige und kalkgepunktete Elefant wird besser als die anderen, Aber auch ihn erwartet das grausame Schicksal – wie eine glänzende Blase auf dem Fluss zu schwimmen. Ich verlasse den Elefanten. Ich gehe und denke nach. Es ist genug, ich werde keine Elefanten mehr machen. Wieso soll ich Blätterfall und seiner ungewöhnlichen Sauberkeitsauffassung das Leben schwer machen? Aber halt! Er sieht die Sauberkeit von den Straßenbahnschienen bis zur Ziegelwand, und sein Blick bringt achtzig Rubel monatlich ein. Mein Elefant aber kostet keine halbe Kopeke. Nicht mal ein „danke“ gibt es dafür …
Am nächsten Abend treffe ich anstelle des sauber gefegten, für die Arbeit vorbereiteten Platzes den Elefanten. Und ich tue etwas Unbegreifliches. Aus dem vorbereiteten Draht biege ich einen Dietrich. Ich öffne die Holzkiste, in der Blätterfall sein Werkzeug aufbewahrt. Ich nehme die Schaufel und einen neuen Besen, der noch nie Asphalt gesehen hat. Ich gehe zum Elefanten und schlage den grünen Kopf ab. Lege ihn auf die Schaufel, trage ihn zum Fluss und werfe ihn hinein. So traurig es auch sein mag, ich schiebe auch den braunen Nylonkörper auf dem Fluss davon. Dann reinige ich den Platz und zünde mir eine Zigarette an. Ich denke an Blätterfall, daran, dass er einen blauen Krankenschein bekommen wird, der in der Buchhaltung der Hausverwaltung ausbezahlt wird. Dieser Zettel wird früher oder später auf dem Müll landen, und jemand wird daraus ein Papierboot falten können.
Die Sonne scheint.
Die Übersetzungen dieser Texte und die Veröffentlichung im Rahmen des dekoder-Specials Durch die Nacht, durch den Sturm – Literatur aus Belarus entstanden mit freundlicher Unterstützung des Goethe-Instituts im Exil, das 2024 einen Länderschwerpunkt Belarus präsentiert.
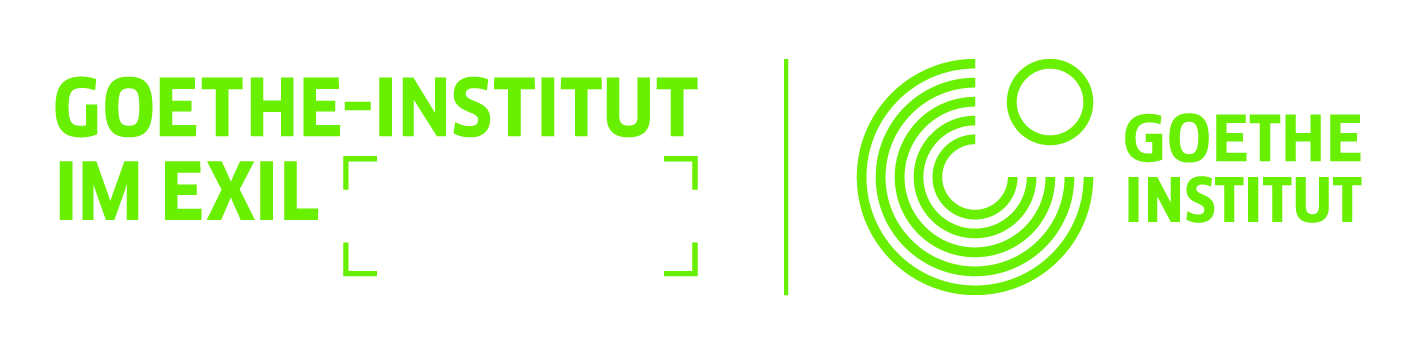



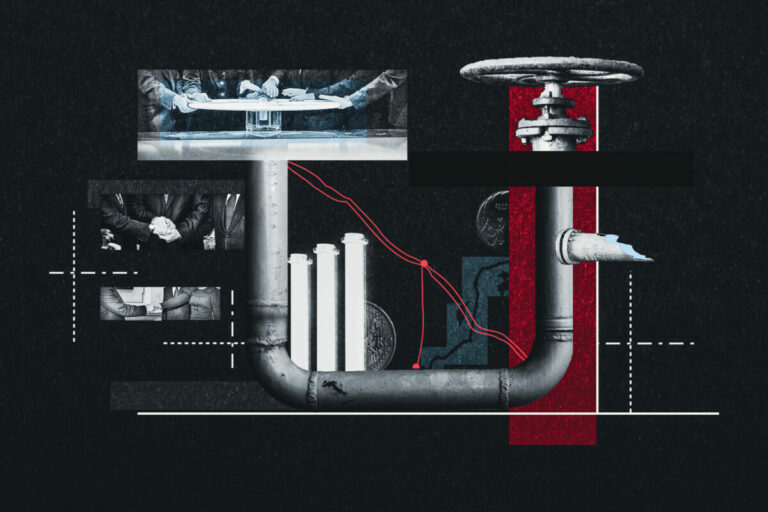




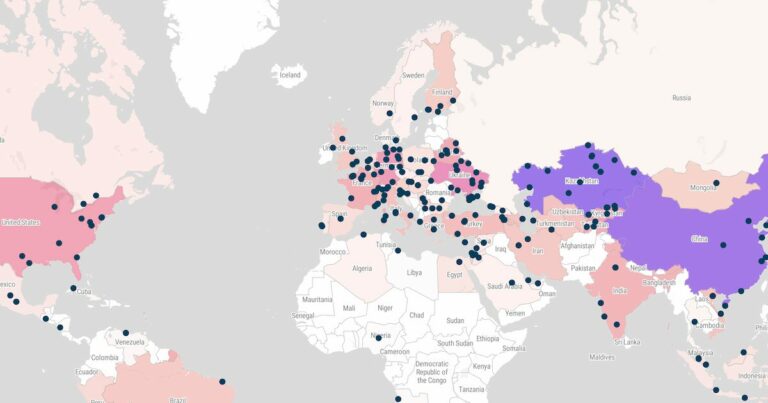





































![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)










