
Hapeyeva
Poste restante
Ein Schlüsselmoment seien die Proteste im vergangenen Sommer gewesen, sagte Volha Hapeyeva in einem Interview. „Wir waren davor ein bisschen atomisiert, denn die Menschen sprachen nicht viel und verbrachten viel Zeit zu Hause. Wir konnten uns nicht einmal vorstellen, dass diese Massen existieren.” Volha Hapeyeva ist eine der bedeutendsten lyrischen Stimmen ihres Landes. Sie hat zahlreiche Poesiebände veröffentlicht, als Sprachforscherin beschäftigt sie sich mit Genderfragen. Anfang 2020 erschien ihr viel gelobter Debütroman Camel Travel auch auf Deutsch. Sie war seit Oktober 2019 nicht mehr in Belarus, aktuell befindet sie sich in München. Wie schaut Volha Hapeyeva als Nomadin auf das, was in Belarus passiert? Wie hat das sie selbst verändert? Darüber schreibt sie in diesem Text.
Morgens bringe ich den Mut auf, die Nachrichten zu lesen, eine halbe Stunde später breche ich in Tränen aus und spüre, wie ich den eigenen Körper verlasse und irgendwo im luftleeren Raum schwebe, quasi auf den Fluren der Universität unterwegs bin, an der ich früher gearbeitet habe, sehe, wie Kolleginnen entlassen werden, durch die Straßen von Minsk gehe und sehe, wie jemand festgenommen und in ein Auto gesteckt wird, sehe, wie Büros und Wohnungen durchsucht werden, wie sie zuschlagen, hassen.
Manchmal spiele ich ein Spiel, das man „Bewusstseinstäuschung“ nennen könnte. Unterwegs im Zug durch grüne Landschaften stelle ich mir vor, ich wäre dort, in meiner Heimat, und es gelingt tatsächlich für eine gewisse Zeit, das ist bestimmt die Erinnerung, die sich so äußert – sehr entspannend, weil alles so vertraut scheint, aber dann folgt eine unsägliche Traurigkeit und Anteilnahme, fast eine Todes- und Endlichkeitsahnung, zugleich aber auch der Atemhauch des Universums. Die Augen brennen, die Kiefer mahlen. Ich atme tief durch und tauche wieder auf aus meinem Spiel. Der Schaffner sagt an: „Aufgrund von Bauarbeiten muss der Zug Zürich-München umgeleitet werden.“
Eine neue E-Mail, ein Fotograf möchte ein Shooting machen, er interessiert sich für Autoren im Exil. Da geht mir auf, dass ich mich nicht in diesem Status denken möchte, als wäre dies das Eingeständnis, dass es wirklich schlimm steht und dass ich (wir) Hilfe brauche(n). Es ist wie der Ausbruch aus einer missbräuchlichen Beziehung – ohne Psychotherapie und Unterstützung von außen geht es nicht.

Im vergangenen Jahr wurde mir häufiger als je zuvor die Frage nach der Heimat gestellt, was das für mich bedeute und wo sie liege. Individuen wie ich fallen aus dem Normalbild heraus und müssen irgendwie definiert werden. Für unser Gehirn ist es von paranoider Wichtigkeit zu kategorisieren und zu klassifizieren, um zu klären, in welche Schublade diese oder jene Erscheinung und dieses oder jenes Exemplar einzuordnen ist. Diese Prozesse vollziehen sich mittels der Sprache. Dann schauen wir doch mal, was sie mir anzubieten hat: Emigrantin, Geflüchtete, Exilantin – alles Ausdrücke, die aus der Position der Staatlichkeit formuliert sind. Da ich nicht in diesen Terminologien denken möchte, verfalle ich auf die Nomadin.
Über Wörter nachzudenken, ist gewissermaßen meine Berufskrankheit. Die deutsche Heimat ist dort, wo du dich heimisch fühlst, die belarussische radzima ist der Ort, an dem du geboren bist. Geboren bin ich in Minsk, aber ist Minsk deshalb meine Stadt? Eher nicht, sie gehört schon lange nicht mehr den Menschen, sie ist Hauptstadt der Republik.
Mein Belarussisch hat gewisse deutsche Züge bekommen
Meine langen Jahre auf Wanderschaft ohne festen Wohnsitz haben mich dazu gebracht, auch ein Hotelzimmer, ein Eckchen bei Freunden oder eine Stipendiatenunterkunft mein Zuhause zu nennen. Wenn ich mich aber frage, wo ich mich zu Hause fühle, kommen mir kein Land und keine Stadt in den Sinn. Mein Zuhause ist auf dem Feld, im Wald, am Ufer eines Sees oder Baches – alles Orte, die nicht staatlich sind, jenseits von Polis und Nation, sie sind Natur, und ich bin dort Mensch, einfach Mensch. Weder Volha, noch Belarussin, noch Dr. phil.. Dort fragt niemand nach Visum, Status, Pass oder Meldeadresse.
Das Leben hält unendlich viele Zumutungen bereit, man kann sich ärgern darüber, darauf warten, dass das endlich aufhört, kann sein Schicksal verfluchen. Oder man versucht, aus der Situation zu lernen. Ich lerne, offener zu sein und mehr Zutrauen zu entwickeln, denn „in der Fremde“ kann einen alles Mögliche aus der Fassung bringen. Die Angst, nicht verstanden zu werden, die Angst, etwas verkehrt zu machen. Du gehst Gespräche und Treffen vorher im Kopf durch, gleichst ständig ab, ob etwas hier so üblich ist. Seltsamerweise habe ich das alles auch schon getan, als ich noch in „meinem“ Land lebte. Es heißt, das Zuhause sei der Ort, an dem man sich geborgen und sicher fühlt. Wie viele meiner Landsleute würden das wohl aktuell von der Republik Belarus behaupten?
Ich bestreite gerade viele Lesungen und Veranstaltungen, die Welt hat plötzlich ihr Interesse an Belarus entdeckt. Immer wieder muss ich historische Ereignisse einordnen, soziokulturelle Besonderheiten des Landes erklären und linguistische Auskünfte über die belarussische Sprache erteilen.
Ich bin mir inzwischen unsicher, in welcher Sprache ich schreibe und denke, mein Belarussisch hat gewisse deutsche Züge angenommen, und aus meinen Deutsch lugt bestimmt das belarussische Unterfutter hervor. Aber ich mache mir nicht mehr so große Sorgen darüber, dass ich kein sesshaftes Leben führe, da mir klar geworden ist, dass ich von einem Tag auf den anderen gezwungen sein könnte, Land und Sprache zu wechseln. Deshalb lerne ich, nicht zu haben, sondern zu sein. Mir selbst Heimat zu sein, Liebe und Poesie.



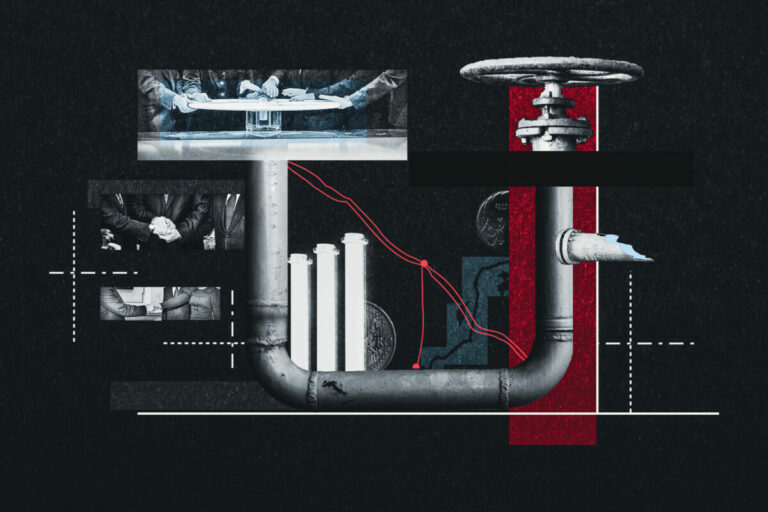




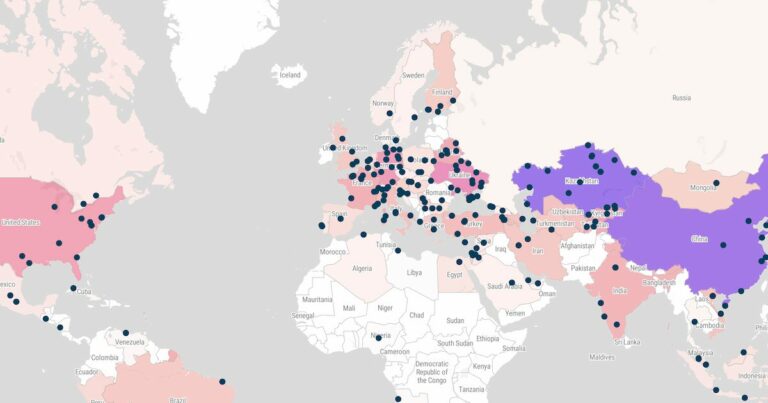





































![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)










