Eine kurze Lovestory
Bis zum Zerfall der Sowjetunion war das Verhältnis der Russen zu den USA ambivalent. Es gab drei Sichtweisen: Die Revolutionäre und die radikalen Reformer sahen in den USA ein Land der Utopie, in dem alle Träume wahr geworden waren. Die Konservativen und die Befürworter eines starken Staates erblickten in den USA in Zeiten eigener Unsicherheit eine Bedrohung, die sich durch den Kalten Krieg nur noch verstärkte. Die USA waren für sie nicht nur ein Beispiel für einen „Verfall“, sondern auch ein wirtschaftlicher Gegner und ein potenzieller militärischer Feind. Die staatlichen Reformer schließlich sahen in den USA schon seit Nikolaus I. das Land der Technologie und Methoden, die die wirtschaftliche Effizienz steigern können.
Im Zuge der Perestroika wurden die Reformer der „Gorbatschow -Ära“ nach und nach von Revolutionären aus dem „Team Jelzin “ verdrängt, und 1991 endgültig von den politischen Schaltstellen entfernt. Dabei hatten beide Gruppen Amerika traditionell als positives Beispiel betrachtet. Die Konservativen, die den USA mit Skepsis begegneten, erlebten gemeinsam mit dem Staatskomitee für den Ausnahmezustand eine Niederlage . Die Perestroika weckte bei den Eliten die Hoffnung, Russland könne im Bund mit den USA „in die europäische Kultur zurückkehren“. Diese Hoffnungen speisten sich aus einer schnellen politischen Annäherung der beiden Länder. 1990 unterstützte die Sowjetunion die USA in ihrer Reaktion auf die irakische Invasion Kuwaits – eine Entscheidung, die fünf Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre.
In den Neunzigern haben die Reformer nur selten auf antiamerikanische Losungen zurückgegriffen – der Antiamerikanismus hatte keine Konjunktur. In der Massenkultur jener Zeit waren die USA eindeutig positiv konnotiert , man kann aber annehmen, dass die Menschen sich dabei weniger Gedanken um den Modellcharakter für einen soziopolitischen Aufbau machten.
Politiker, die die USA als Freund und Partner betrachteten, besetzten prominente Posten im Staatsapparat. Möglicherweise haben damals auch viele Staatsbeamte von sich aus ein positiveres Verhältnis zu den USA entwickelt. Meistens führt man hier Wadim Bakatin als Beispiel an. Bakatin wurde im Herbst 1991 zum Chef des KGB und übergab den Vereinigten Staaten (in Absprache mit Michail Gorbatschow und Boris Jelzin) einen Plan der Abhörgeräte im neuen Gebäude der US-amerikanischen Botschaft. Die politische Führung der Sowjetunion und Russlands rechnete mit vergleichbaren Gesten von Seiten der USA, doch diese blieben aus. Vor Bakatins Rücktritt im Januar 1992 bot Jelzin ihm einen Posten als Botschafter in den USA an. Er lehnte ab. Ein nicht minder schillerndes Beispiel für einen „proamerikanischen Kurs“ war Andrej Kosyrew, russischer Außenminister von 1990 bis 1996. Seine Kritiker nannten ihn „Mister Ja“ (in Abgrenzung zu seinem Gegenspieler Andrej Gromyko, spöttisch „Mister Nein“ genannt). Es gibt Quellen, wonach Kosyrew sich zur Frage der Formulierung von nationalen Interessen des neuen Russland an James Baker gewandt haben soll, Stabschef im Weißen Haus.
Dass es solche „proamerikanisch“ eingestellten Politiker in hohen Regierungsämtern gab, hatte zwei wechselseitige Gründe: Die russische Führung war an einer Annäherung mit dem Feind von gestern interessiert, der sagenhafte Vorteile von der Selbstauflösung des Sowjetsystems davongetragen hatte. Man rechnete damit, dass die US-Eliten dieses Interesse erwidern. Zudem durchlebte ein beträchtlicher Teil der russischen Gesellschaft eine Identitätskrise („Wir waren Sowjetmenschen, und wer sind wir jetzt?“) und liebäugelte dabei mit den USA.
Die Einstellungen änderten sich nach und nach. Viele Faktoren spielten in das Verhältnis der Russen zu den USA hinein: Die Reformen und der wirtschaftliche Zusammenbruch zogen Probleme nach sich, bei denen die Vereinigten Staaten nur unzureichend halfen, so die verbreitete Meinung. Das führte bei einem Großteil der Bevölkerung zu Enttäuschung. Hatten sich doch die Russen (und Sowjetbürger) freiwillig gegen den Kommunismus entschieden und aufgehört, der größte Feind Amerikas zu sein. Dafür verdienten sie doch ernstzunehmende Unterstützung in den schwierigen Zeiten der Reformen. Doch in den USA waren Zeiten des Triumphs angebrochen. Statt der Vorstellung, dass „wir gemeinsam den Kalten Krieg beendet haben“ verbreitete sich ein anderes Narrativ: „Die USA haben die Sowjetunion besiegt“. Derweil festigte sich in Russland der Eindruck, die USA wollten Russland gar nicht als einen neuen, gleichberechtigten Partner der westlichen Gemeinschaft, vielmehr wollten sie Russlands Schwäche ausnutzen, um die eigenen Interessen durchzusetzen.
Der russische Politikwissenschaftler Alexej Bogaturow erklärt, Russland habe in der ersten Hälfte der 1990er Jahre die US-amerikanische Außenpolitik unterstützt, ohne die eigenen Interessen zu berücksichtigen. Damit hätten sich die russischen Eliten an den Grundsatz der „demokratischen Solidarität“ halten wollen, demzufolge sich „alle demokratischen Länder (Russland eingeschlossen) solidarisch verhalten, aufeinander Rücksicht nehmen sollen, so wie es sich für Staaten mit gemeinsamen Interessen gehört“. Daher begrüßte man sogar das im September 1993 vom Weißen Haus verlautbarte Konzept der „Demokratie-Erweiterung“, das, wie sich später herausstellen sollte, auf die Hilfe für ehemalige Mitgliedsländer des Warschauer Paktes „mit Ausnahme von Russland“ ausgerichtet war, und das „zur vollständigen Zerstörung von deren wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zu Moskau beitrug“.1
Pjotr Awen, Mitglied der ersten postkommunistischen Regierung Russlands, erklärte später: „Als wir an die Macht kamen, hofften wir sehr auf Unterstützung aus dem Westen. Wir waren überrascht und enttäuscht, dass diese sehr gering ausfiel. 1992 erhielten wir eine Milliarde US-Dollar vom Internationalen Währungsfonds. Und von den westlichen Regierungen gar nichts. Als sich hingegen Ende der 1990er Jahre die Krise in Mexiko ereignete, bekam Mexiko innerhalb weniger Tage vierzig Milliarden Dollar von den USA. Vierzig zu eins. Wobei wir davon ausgegangen waren, dass Russland wichtiger sei als Mexiko. Wir waren eine Nuklearmacht, deren militärische Abschreckung sich die USA jährlich hunderte Milliarden Dollar kosten ließen. Trotzdem konnten wir uns anfangs nicht einmal mit dem Pariser Club auf vernünftige Konditionen einigen, auf solche, wie sie beispielsweise Polen erhalten hatte … Für Gaidar und Kosyrew, für meine Kollegen und mich, war es ein großer Schock festzustellen, dass die absolute Mehrheit der westlichen Staats- und Regierungschefs nicht bereit war, uns als Partner, und nicht als Gegner, zu betrachten.“2
Strobe Talbott, Russlandbeauftragter unter Bill Clinton, veröffentlichte kurz nach seinem Rücktritt eine Autobiografie, aus der ersichtlich wird, wie die US-amerikanische Regierung bei Verhandlungen mit Russland kontinuierlich ihre eigenen Interessen durchsetzte, ohne jene Russlands zu respektieren oder die Zugeständnisse seitens Russlands anzuerkennen. In dieser Hinsicht bildete die Politik der USA einen Gegensatz zu jener Deutschlands, das offensichtlich versuchte, Russland bei der Integration in die westliche Welt zu unterstützen, und schon bald zu Russlands wichtigstem Partner im Westen wurde.
Talbott zählt mit sichtlichem Vergnügen Fälle auf, bei denen die Ausübung von Druck auf Russland von Erfolg gekrönt war: wirtschaftliche Kompromisse, die Erweiterung der Raketenabwehrsysteme, das Vorrücken der NATO, die Abkehr vom ABM-Vertrag. Letzteres betraf bereits die Präsidenten George W. Bush und Wladimir Putin: „Der russische Staatschef, der nicht zuletzt durch seine Fähigkeit an die Macht gekommen war, sich leise, unauffällig und höflich gegen die USA zu behaupten, gab nun einfach auf, wie schon sein Vorgänger Boris Jelzin.“3 Das Problem war allerdings, dass diese Haltung der USA dem Kreml nicht entging – und das war für eine Zusammenarbeit nicht gerade förderlich.
Zu der Enttäuschung über Amerika trugen auch die amerikanischen Berater russischer Reformer bei, die während ihrer Arbeit in Russland der Korruption beschuldigt wurden. 1997 stand Andrej Shleifer vor Gericht, ein Harvard-Professor, der in Moskau die Mittel der United States Agency for International Development verwaltete. Er unterstützte die russische Regierung bei der Entwicklung der Privatisierungspläne und brachte den russischen Investoren und Beamten westliche Standards bei der Verwaltung und Regulierung bei. Russische Kritiker der US-Hilfen sahen in dem Prozess „einen Beweis dafür, dass die USA versuchen, die Hilfen für ihre eigenen Interessen zu nutzen.“4
Zu der enttäuschten Hoffnung der russischen Eliten, man könne die Spaltung überwinden und mit Hilfe der USA zu einem Teil des Westens werden, kamen 1999 noch strategische Konflikte wegen der Jugoslawienkriege und vor allem der Schock über die Bombardierung Serbiens.
Prof. Angela Stent, eine beteiligte Zeitzeugin und Erforscherin der russisch-amerikanischen Beziehungen dieser Zeit, erklärt, das Hauptproblem bei der Integration Russlands in westliche Wirtschafts- und Sicherheitsstrukturen wie die NATO oder die EU sei, „wie es jemand von der Clinton-Regierung einmal ausdrückte, dass sich diese Russen ‚nicht einfach so eingliedern lassen‘“. Beim Eintritt in Organisationen hofften sie, diese mitzugestalten, und nicht „klaglos die bestehenden Regeln zu akzeptieren“.5 Gleichzeitig wuchs unter den russischen Eliten der Unmut über die Bestrebungen der Clinton-Regierung, eine monopolare Weltordnung mit den USA an der Spitze zu errichten, und über das US-Establishment, das nur darüber stritt, ob man eine „Führerschaft“ oder eine „Hegemonie“ wollte.6
Der US-amerikanische Forscher Paul Hollander nennt zwei Hauptgründe für Antiamerikanismus in der Welt: die Ablehnung der schnellen Modernisierung und den damit verbundenen Verlust traditioneller Werte, woran man oft den USA als dem Weltführer in der Modernisierung die Schuld gebe. Und den wachsenden Nationalismus als Folge eines Gefühls der „Bedrohung durch und die Abhängigkeit von einer Weltmacht, ihrer globalen Präsenz, ihrem wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Einfluss“. Im Vorwort zur russischen Ausgabe seines Buchs aus dem Jahr 2000 verweist Hollander darauf, dass der russische Antiamerikanismus des vorangegangenen Jahrzehnts von Gründen aus Letzterem hervorgerufen wurde. Denn Russland befand sich in einer Phase schwerwiegender Probleme, „in der es seine politische, wirtschaftliche und militärische Macht einbüßte“.7 Man könnte dieser Meinung zustimmen und darin sogar einen Vorboten des Antiamerikanismus der „ersten Variante“ sehen, der im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in Russland Verbreitung finden wird.
Eine umfassendere Analyse des russischen Antiamerikanismus bietet eine Publikation der Soziologen Boris Sokolov, Ronald F. Inglehart, Eduard Ponarin, Irina Vartanova und William Zimmerman.8 Die Autoren legen dar, dass sich der ursprüngliche Antiamerikanismus nicht aus Differenzen bei persönlichen Begegnungen speiste, sondern aus einer „emotionalen und ideologischen Enttäuschung“ von den Ergebnissen der prowestlichen Reformen, die sich zuerst unter den liberalen Intellektuellen ausbreitete. Als erstes wandten sich höhere Bildungsschichten dem Antiamerikanismus zu – eben jene, die zuvor am meisten auf die Reformen gehofft und die USA idealisiert hatten, wurden von ihrem Ideal enttäuscht. Zudem behaupten die Autoren, es habe bis Ende der 1990er Jahre keinen flächendeckenden Antiamerikanismus gegeben, bis die Eliten angefangen hätten, ihn zu instrumentalisieren, um die Verantwortung für gescheiterte Reformen auf einen Außenstehenden zu übertragen. Obendrein hätte die US-amerikanische Außenpolitik Ende der 1990er und darüber hinaus genug Anlass für eine negative Einstellung gegenüber den USA gegeben.
Diese Thesen lassen sich noch ergänzen: Für höhere Bildungsschichten (die einst die Basis für proamerikanische Einstellungen gebildet hatten) gab es in den 1990ern plötzlich deutlich mehr Möglichkeiten, die USA unmittelbar kennenzulernen: Reisen in die Vereinigten Staaten wurden erschwinglicher und häufiger, ebenso wie das Studium an US-amerikanischen Universitäten, Treffen mit Geschäftsleuten, Missionaren, Touristen, Studenten, und letztendlich auch mit US-amerikanischen Geschäftsmodellen und Kultur (McDonalds und Hollywood kamen nach Russland). Ein unerwarteter Effekt dieses Kennenlernens war die Entstehung eines „Antiamerikanismus des Kennenlernens“ – die nähere Betrachtung Amerikas führte zu einer Enttäuschung, vor allem unter jenem Teil der Bevölkerung, der zuvor eine utopische Sicht auf die USA gehabt hatte.
Einen flächendeckenden Antiamerikanismus der Staatspropaganda gab es in den 1990er Jahren noch nicht, aber die für ihn notwendige Stimmungslage reifte in dem Jahrzehnt bereits. Wladimir Putins Münchner Rede im Februar 2007 war ein Ausdruck der Enttäuschung der russischen Eliten über das Scheitern des Projekts einer „Amerikanisierung Russlands“.
Bogaturov, Alexej (2007): Tri pokolenija vnešnepolitičeskich doktrin Rossii, in: Meždunarodnye processy, T.5, №1, S. 54-69
Aven, Petr (2012): Džejms Bejker: «Vy tak i ne postroili svobodnuju rynočnuju ėkonomiku», in: Forbes, 13.3.2012
Talbott, Strobe (2003): Bill i Boris. Zapiski o prezidentskoj diplomatii, S.493
Robbins, Karla Ėnn (2005): Obidet‘ Rossiju stoit $30 mln, in: Vedomosti, 5.8.2005
Stent, Angela (2015): Počemu Amerika i Rossija ne slyšat drug druga?, S.63
Šakleina, T. A. (2017): Rossija i SŠA v mirovoj politike
Hollander, Paul (2000): Antiamerikanizm: Racional’nyj i irracional’nyj, S. 14
Sokolov, Boris / Inglehart, Ronald F. / Ponarin, Eduard / Vartanova, Irina / Zimmerman, William (2018): Disillusionment and Anti-Americanism in Russia: From Pro-American to Anti-American Attitudes, 1993–2009, in: International Studies Quarterly, Volume 62, Issue 3, September 2018, S. 534–547


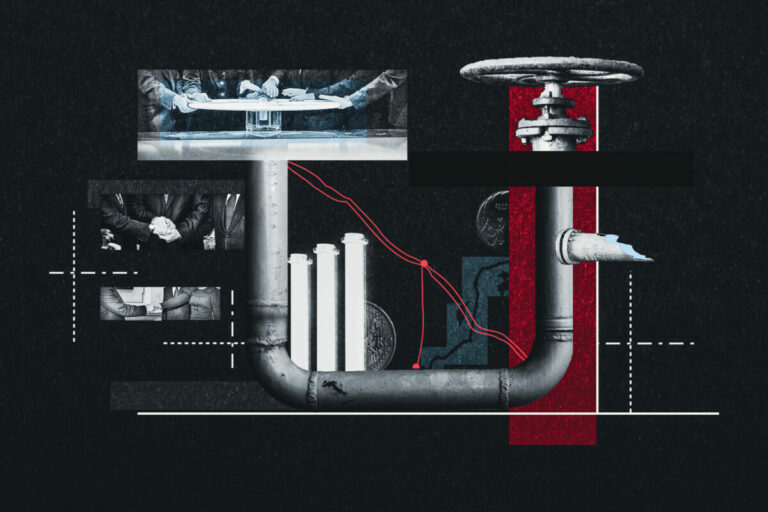




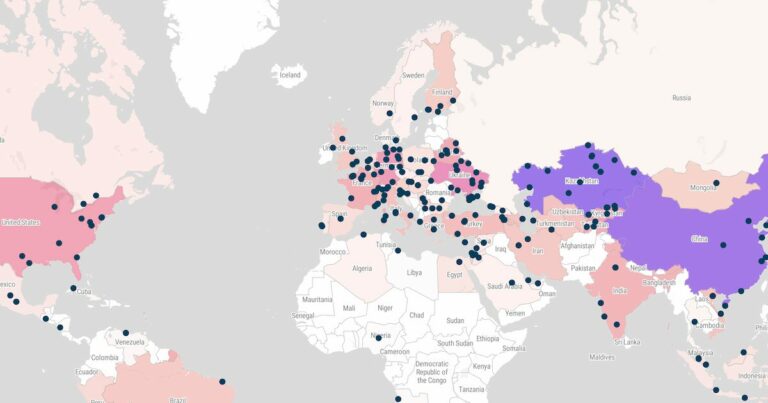





































![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)










