Das Großfürstentum in den Wolken
Als Belarus mit dem Ende der Sowjetunion im Jahr 1991 die Unabhängigkeit erlangte, forcierte sich auch die Suche nach einer nationalen Identität und einer eigenen Geschichtsschreibung. Abseits sowjetischer Narrative und Doktrine. In dieser Zeit des Aufbruchs wurde das Großfürstentum Litauen sozusagen einer der Dreh- und Angelpunkte dieser Suche. In seinem Beitrag beschreibt der belarussische Philosoph Ihar Babkou die Rolle des Großfürstentums für die damaligen Hoffnungen und Sehnsüchte der Belarussen.
Es schien wie ein Wunder und Geschenk: Am Ende des Jahrhunderts des Holocaust und der Bloodlands ersteht in diesen Gefilden ein merkwürdiger Traum. Zu Beginn der Neunziger flüsterten wir Großfürstentum wie eine Parole, und in diesem Flüstern war zu viel von allem eingewebt. Träume von einer Geschichte ohne Konzentrationslager und ohne Aufseher, Städte und Schlösser, in denen man leben und Freude üben konnte, nicht nur das Verstecken vor der verrotteten Macht. Eine Zeit, als in Städten und Gutshäusern Gemälde und Bücher gesammelt wurden, als Bibliotheken nicht brannten oder als Beute gen Osten oder Westen abtransportiert wurde.
Einst war es anders, sagten wir uns, also kann es auch künftig anders sein. Das Großfürstentum schaute uns aus der Zukunft an. Wie eine utopische Kultur, die eine Perspektive eröffnet. Wie Tiefe und Hoffnung. Wie eine Hand, die den fast Ertrinkenden ans Ufer zieht, der den Kampf und das Überleben in den Albträumen einer fremden Geschichte müde war.
Später tragen die Historiker tragische Farben auf: im 15. Jahrhundert Švitrigaila und der Krieg zwischen Litauen und der Rus , im 16. Iwan der Schreckliche und die Plünderung von Polazk, im 17. der langsame Niedergang, das Ende der Vielfalt. Im 18. Überhaupt nur fremde Heere, totale Okkupation, das Ende von allem. Ja, all das ist geschehen. Sintflut, Zerstörung, Brände, Truppen.
Doch es gab auch anderes. Der Reisende Skaryna, der alle nur möglichen Formen durchdrungen, alle Bücher übersetzt und alles erklärt hat. Sapieha , der so stolz war, dass es nun „ein in unserer Sprache geschriebenes Gesetz“ gab. Jesuitenschulen, in denen Vergil auswendig gelernt, Aristoteles und Cicero gelesen wurde und man sich vorbereitete weiterzukommen, nach China und Indien. Die Basilianer, die Westen und Osten verknüpften, geduldig den hiesigen Jugendlichen Griechisch und Latein nahebrachten.
Dichter und Denker, Gelehrte und Künstler. Menschen des Geistes.
Eine Vergangenheit, die nützlich sein kann. Schützt und bewahrt die Gedanken. Bleibt auf der Höhe. Mit der Zeit beginnen wir sie tiefgründiger zu verstehen, tragischer, sehen sie genauer. Die anfängliche Erhabenheit verschwindet dabei nicht. Und vor allem – es bleibt die Freude.

Was tut es schon zur Sache, wer spricht, sagte Michel Foucault einmal. Wichtig ist der Diskurs selbst, das Sprechen. Dieser Fluss, der in den Tiefen des Herzens beginnt, nach außen strebt, sich Bahn bricht, seinen Inhalt und seine Form sucht.
Was tut es schon zur Sache, wem das Großfürstentum gehörte, möchte ich den Diskussionen der Historiker oft erwidern. Wer sein Herr und Besitzer war. Und wie lange es am seidenen Faden der Geschichte hing.
Es hat sich schon längst von seinem Boden und aus seiner Zeit gelöst. Ist davongeflogen. Wurde nicht nur zum schönen Bild, sondern auch zum Archiv kultureller Codes, zur Bibliothek der Träume, zum Laboratorium der Zukunft. Heute ist nicht wichtig, wem es gehörte und wer dort herrschte. Sondern woran wir uns erinnern. Was wir herauslesen und was wir zurückholen. Von dort, aus der Vergangenheit.
Die belarussische Kultur kann heute nur als Kultur des großen Stils existieren, sagt M. Gerade weil sie umgeben ist von peripherem Kapitalismus, ewiger Nachahmung, postkolonialen Comics. Wenn du mit der Schnauze ständig ins Unmögliche gestupst, an der Leine gehalten wirst: Das gehört euch nicht, das könnt ihr euch nicht leisten, wartet noch ein Weilchen in diesem Vorzimmer, bis wir entschieden haben, was wir weiter mit euch anstellen. Deshalb ist es sinnvoll, sich nur mit den allerwichtigsten Fragen zu beschäftigen. Der Metaphysik.
Wir sitzen in Swershan, auf der Terrasse eines alten Hauses. Vor uns die ehemalige protestantische Kirche, umgewandelt in eine katholische, und die ehemalige unierte Kirche, umgewandelt in eine orthodoxe. Geht man ein Stück weiter, stehen dort noch die Mauern einer Synagoge. Die Moschee gibt es nicht mehr, doch ihr Schatten geistert noch umher. Und der Njoman. Er beginnt ein paar Hundert Meter von hier und fließt zur Ostsee, nach Kaliningrad.
M. hat ein Gedicht über das Großfürstentum geschrieben. Darin wartet der Protagonist, Witaut des Universums, nachdem er eine unmögliche Lebensfülle, alles Glück des Seins gesammelt und alle Geheimnisse der Finsternis erreicht hat, im ewigen Fest der vollen Kelche auf das Eintreten des Herrschers der Not wie auf einen ungebetenen Gast. Das Gedicht ist enorm fröhlich, gleichzeitig aber beklemmend, erschreckend gar. Noch dauert das Fest. Aber niemand weiß, was weiter geschehen wird, wenn der Herrscher des Defizits tatsächlich erscheint. Das ähnelt dem Abschnitt der Bhagavadgita, in der Krishna seinem Schüler Arjuna sein wahres Gesicht zeigt, sage ich. Und dieses Gesicht erweist sich als die Zeit, die alles offenbart und schafft, und alles verschlingt und dorthin zurückholt, wo die Geheimnisse der Finsternis blühen.
Gerade deshalb sind die Tradition und der kulturelle Kanon, sage ich zu ihm, nicht einfach ein temporäres Konstrukt, nicht nur etwas Subjektives, sondern das Floß und die Arche, auf denen wir alle gemeinsam fahren, das Menschliche rettend und bewahrend.
M. stimmt mir zu und füllt die Gläser nach. Er ist ein Dichter, Kenner des Sanskrits, Übersetzer der Bhagavadgita ins Belarussische. Wir sitzen am Lagerfeuer, 2020 steht vor der Tür. Es dämmert. Der Herrscher der Not ist nah.
In dreißig Jahren ist alles schwerer geworden, hat an Inhalt und Gewicht zugenommen. Viele Bilder und Ideen wurden durchlebt und verworfen oder vergessen. Aber einige Dinge sind mit der Zeit wieder aufgetaucht. Sie haben das Zufällige, Nebensächliche verloren. Sie sind geblieben.
Das Großfürstentum als Atemzug. Einatmen in die muffige, überfüllte Kammer der gewohnten und verhassten Gegenwart. Wie der heimische Winkel, der sich plötzlich der Welt öffnet. Und die Fähigkeit erlangt, aufzuerstehen und zu fliegen. Die große Gleichheit und die große Gerechtigkeit, alles Lebendige zu erblicken. Die große Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit der Menschen, Vögel und Bäume zu spüren. Man selbst zu sein inmitten des Großfürstentums in den Wolken.
Wem gehört dieses Großfürstentum, wer könnten seine Bewohner und Bürger sein? Die Dichter natürlich.
Denn: „Was bleibet aber, stiften die Dichter.“




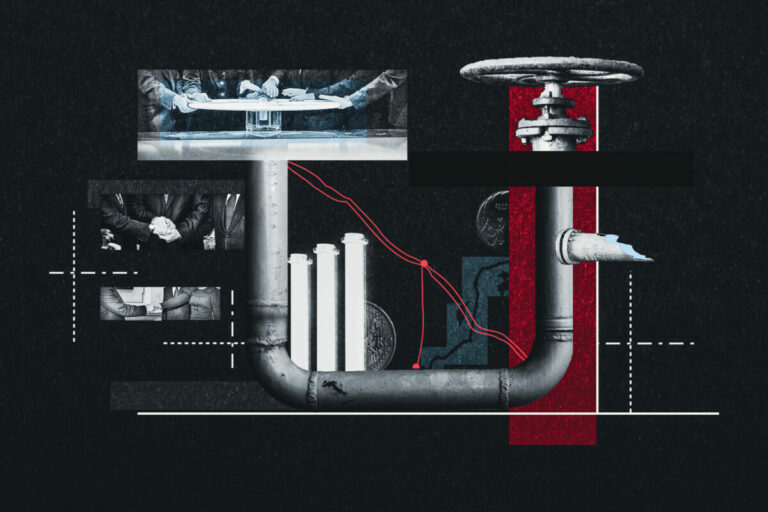




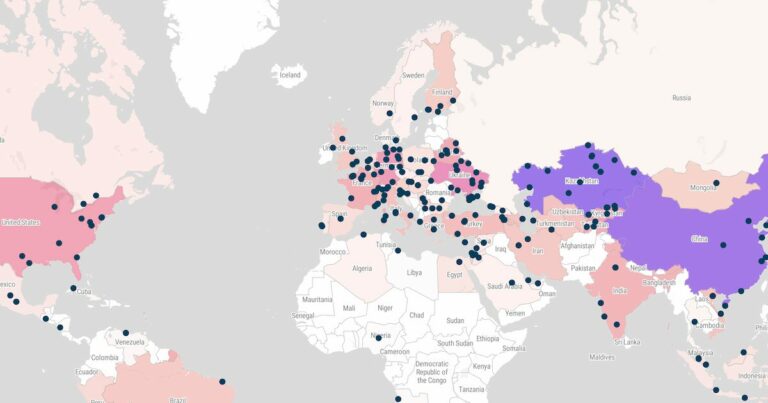





































![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)










